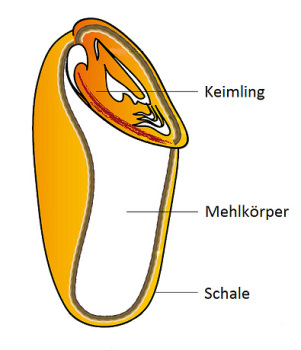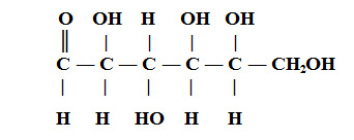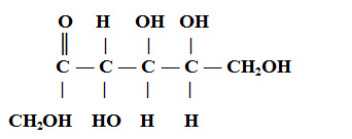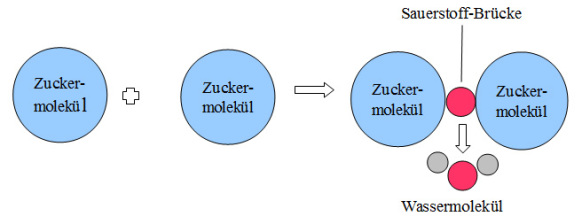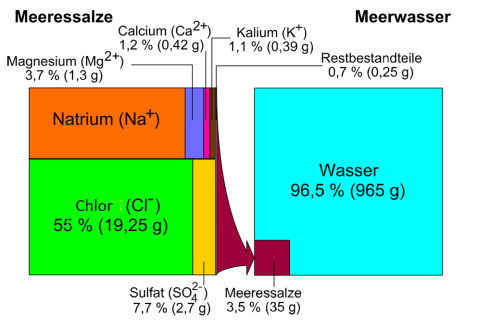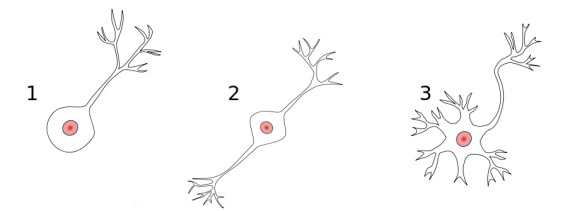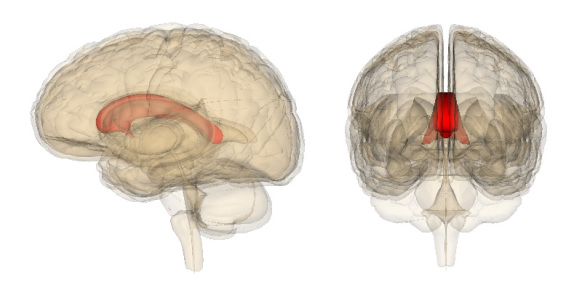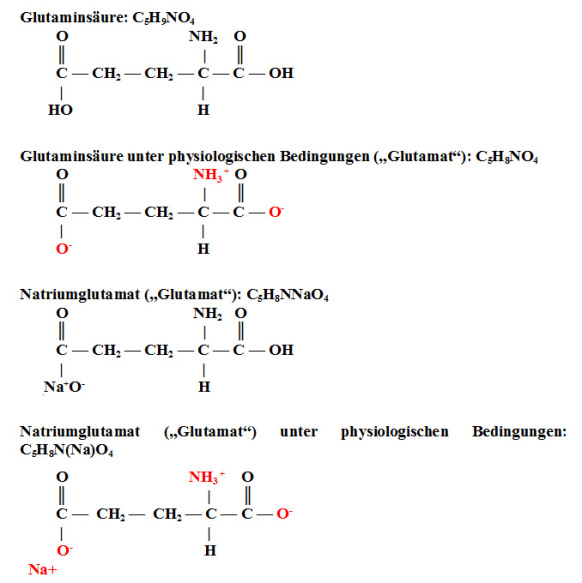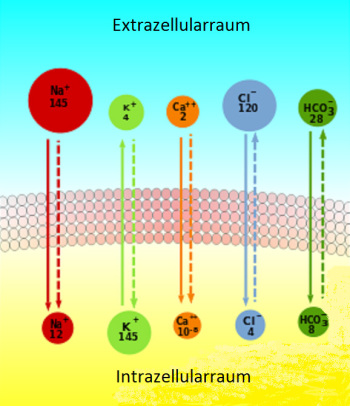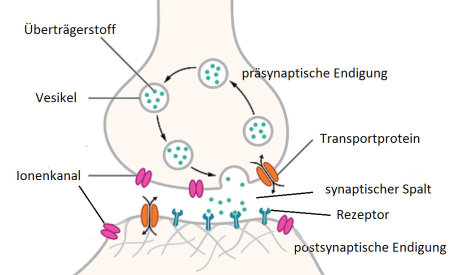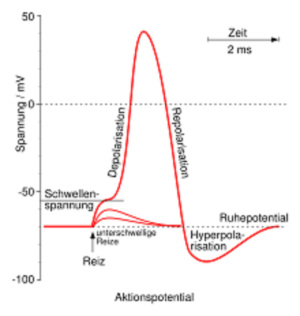Homo sapiens - der weise Mensch
Nr. 9 einer Artikelreihe über die Ernährung
Alle Lebewesen nehmen Nahrung zu sich. Sie gewinnen Energie daraus, zum einen um ihr Bewusstsein aufrechtzuerhalten und - im Schlaf – wiederherzustellen, zum anderen um ihren Körper am Leben zu erhalten. Sie verwenden darüber hinaus in der Nahrung enthaltene Stoffe sowohl als Baumaterial wie auch als Hilfsstoffe.
Die Energiequelle ist immer der Kohlenstoff. Lebewesen haben zwei Arten von Stoffwechsel, um an Energie zu gelangen. Es gibt den Stoffwechsel der Pflanzen und den der Tiere 1. Mikroorganismen können pflanzlicher oder tierischer Art sein.
Pflanzen verwenden Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid. Sie gewinnen Energie aus Kohlendioxid mithilfe von Sonnenlicht und Wasser, wobei sie Traubenzucker („Glucose“) bilden und Sauerstoff freisetzen. Die Glucose ist Ausgangsstoff, um zusammen mit Mineralstoffen und Wasser komplexere Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße herzustellen: ihre körperliche Substanz, in der sich auch Vitamine und weitere Vitalstoffe finden. Pflanzliche Kohlenhydrate machen den größten Teil der irdischen Biomasse („organische Materie“) aus. Gräser sind die grundlegende Nahrung der Tiere.
Tiere nehmen die Nahrung auf, wobei sie auf die Mitwirkung einer Darmflora – hauptsächlich Bakterien - angewiesen sind. Sie verdauen die Nahrung und nutzen den aus den Nährstoffen - Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen - erhaltenen Kohlenstoff, um mithilfe von Sauerstoff und unter Abscheidung von Kohlendioxid und Wasser zu Energie zu kommen. Aus anderen Stoffen - Mineralien, Vitaminen und anderen Vitalstoffen - lässt sich keine Energie gewinnen; sie dienen allein dem Ablauf von Verdauung und Stoffwechsel und dem Auf- und Abbau körperlicher Stoffe. Manche Tiere ernähren sich auch von anderen Tieren - deren Nahrung aber wiederum Pflanzen sind.
Die Ernährung der Menschen wie der Tiere beruht gleichermaßen auf Pflanzen, entweder durch den direkten Verzehr oder durch den Verzehr von pflanzenfressenden Tieren. Der wesentliche Unterschied hat mit den Fähigkeiten des Menschen zu tun, die er u. a. dafür einsetzt, um seine Nahrung zu bearbeiten, bevor er sie zu sich nimmt.
Tiere leben gewöhnlich von frischer Nahrung - solange man keine Haustiere aus ihnen gemacht hat. Fische fressen lebende Pflanzen oder lebendes Kleingetier. Wale fressen lebendiges Plankton. Rinder fressen lebendige Gräser. Löwen fressen Gazellen, deren Blut noch warm ist. Affen fressen Früchte, die gerade noch am Baum hingen. Natürlich gibt es auch Aasfresser; doch sie sind selten und haben ein besonders ausgestattetes Verdauungssystem, mit dem sie sich in Notzeiten auch Nahrung erschließen können, die für andere Tiere giftig ist. Menschen gehören sicherlich nicht dazu.
Doch Menschen haben von jeher versucht, Nahrung haltbar zu machen, um auch dann zu essen zu haben, wenn die Umgebung nichts dergleichen hergibt – oder wenn sie gerade keine Zeit haben, Beeren zu pflücken oder auf die Jagd zu gehen. Das scheint das Grundproblem.
Der Mensch ist fähiger als alle anderen Lebewesen. Man nennt ihn deshalb ja auch Homo sapiens (lat. „der weise Mensch“). Doch leider reichen seine Fähigkeiten oft nicht weiter, als sich das Leben schwer zu machen.
Das Grundnahrungsmittel Nummer eins
Das Bestreben, Nahrung haltbar zu machen - gepaart mit ebenso viel Unwissenheit wie Geldgier -, hat im Laufe der Zeit zu einer Reihe sonderbarer Entwicklungen geführt. Eine davon betrifft Getreide: von Haus aus Grundnahrungsmittel Nummer eins.
Das Beste für die Schweine
Getreide ist nicht naturgegeben. Alle Getreidearten sind Züchtungen aus wilden Gräsern. Die hauptsächlichen Arten sind Weizen, Roggen, Gerste, Hirse, Hafer, Mais und Reis. Ihre Samen, die Getreidekörner, haben allesamt den gleichen Aufbau (siehe Abbildung 1) 2. Den größten Teil des Volumens nimmt der Mehlkörper ein. Er enthält Kohlenhydrate in Form von Stärke, die durch Klebereiweiße („Gluten“) zusammengehalten werden. Der Mehlkörper dient der Versorgung des Keimlings, der sich als Anhängsel am Mehlkörper befindet. Der Keimling ist reich an Fetten, Vitaminen und Mineralstoffen. Mehlkörper und Keimling werden von einer mehrschichtigen Schale (auch „Kleie“) umschlossen. Sie enthält (im Unterschied zum Gluten) lösliche Eiweiße, Fette, Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe.
Abb. 1: Weizenkorn. Querschnitt im Schema.
Natürlich hatte man von Anfang an das Problem der Ergiebigkeit: „Wie viele Körner muss ich in die Erde stecken, um wie viele aus ihr herauszubekommen?“ Das war das primäre Kriterium für das zu verwendende Getreide. Das war auch einer der Gründe, weshalb man zu Beginn der Neuzeit allmählich von der Hirse abkam. Die Hirse war das meistangebaute Getreide des Altertums und des Mittelalters; und sie ist eines der gesündesten Getreidearten überhaupt 3.
Dass es um die Gesundheit der Menschen im Mittelalter schlecht bestellt war, hatte wenig mit der Ernährung zu tun. Es war in erster Linie auf die katastrophalen hygienischen Zustände in den mittelalterlichen Städten zurückzuführen. Die Pest, die zwischen 1347 und 1353 etwa 25 Millionen Menschen – einem Drittel der damaligen europäischen Bevölkerung – das Leben kostete, wurde durch ein Bakterium ausgelöst, das von Rattenflöhen auf Menschen übertragen wurde. Kleiderflöhe ließen es dann in deren Umgebung kreisen 4-6. Dass die meisten Infektionskrankheiten verschwunden sind, dürfte eher mit der neuzeitlichen Hygiene als mit irgendwelchen Impfungen zu tun haben.
Weizen war ertragreicher als alle anderen Getreidearten. Deshalb wurde er verstärkt angebaut und in Richtung größerer und größerer Erträge weitergezüchtet 7. Weizen hatte aber noch andere Vorteile.
Getreide wurde von alters her mit Reibsteinen und Mörsern zerkleinert und zu einem Brei verarbeitet 8. Aus dem Brei wurden Fladen geformt, die auf Steinen oder in Backöfen erhitzt wurden. Die Fladen mussten aber noch warm gegessen werden, da sie ansonsten steinhart wurden (sie sind aus unerklärlichen Gründen heute wieder in Bioläden aufgetaucht). Doch schon die alten Ägyptern wussten, dass der Brei aufweicht, wenn man ihn etwas stehen lässt, und sich so zu einem lockeren Gebäck verarbeiten lässt 8-10. Es gelang am besten, wenn man Weizen dazu verwendete und wenn man die Körner zuerst zerkleinerte und durch Sieben des Schrots die innere Substanz vom Rest trennte – mit anderen Worten Mehl daraus herstellte.
Wenn man es genügend zerkleinerte und aussiebte erhielt man weißes Mehl - und wenn man Brot daraus machte, Weißbrot 8-10. Farbe und Konsistenz lösten zu allen Zeiten Begeisterung aus. Im alten Ägypten erhielten Beamte als Teil ihres Lohns täglich zwei Laib Weißbrot. Die Römer hatten eine eigene Innung für ihre Weißbrotbäcker. Karl der Große (im Jahre 800 zum Kaiser gekrönt) bestand darauf, dass jeder Königshof über einen Müller verfügte, der weißes Mehl herzustellen wusste. Im 11. Jahrhundert kam Weißbrot auch bei uns in Mode. Der große Durchbruch kam erst im letzten Jahrhundert.
Die Herstellung von Mehl beruht auf wiederholtem Zerkleinern und Aussieben der Getreidekörner 11, 12. Zunächst wird der Keimling entfernt. Der Rest wird in drei Stufen gemahlen. Beim „Schroten“ werden die Körner aufgebrochen; die kleineren Teilchen der Schale werden ausgesiebt. Beim „Auflösen“ werden die noch aneinander haftenden Mehl- und Schalenteilchen weiter zerkleinert und voneinander getrennt. Beim „Ausmahlen“ macht man so lange damit weiter, bis man eine mehlfeine Struktur, möglichst frei von Schalenresten, erreicht hat.
Bei fortgesetztem Ausmahlen erhält der Müller verschiedene Ausmahlungsgrade 12. Der Ausmahlungsgrad gibt an, wie viel Mehl prozentual aus dem Ausgangsgetreide gewonnen wurde. Bei einem Ausmahlungsgrad von 65 % wurden 65 kg Mehl, bei einem Ausmahlungsgrad von 75 % wurden 75 kg Mehl aus 100 kg Getreide erhalten.
Die Mehltype wiederum ist eine Aussage über den Mineralstoffgehalt des Mehls 12. Weizenmehl der Type 550 enthält 550 mg Mineralstoffe pro 100 g Mehl. (Sie bleiben übrig, wenn man das Mehl verbrennt.) Bei der Type 405 sind es nur noch 405 mg. Ausmahlungsgrad und Mehltype stehen also in einem direkten Zusammenhang. Je geringer der Ausmahlungsgrad (je stärker die Aussiebung), desto geringer die Mehltype. Mehltypen gibt es für Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl. Man spricht von Auszugsmehlen. Vollkornmehle habe keine Typenzahl, da sie meist alle Bestandteile des Korns (auch den Keimling) enthalten.
Weizenmehl der Type 405 ist das typische Weißmehl, das in jedem Supermarkt zu finden ist und täglich in ungeheuren Mengen in unzähligen Küchen privater und gewerblicher Art verarbeitet wird 13, 14. Es enthält nichts außer isolierten Kohlenhydraten und Klebereiweißen – nebst Resten von Pestiziden (vom lat. „pestis“, Seuche, Pest + „caedere“, töten: chemische Mittel zur Vernichtung pflanzlicher und tierischer Schädlinge aller Art). Im Ausland wird Weizenmehl in der Regel noch mit Chlordioxid oder Stickstoffverbindungen gebleicht. Was am Weizen nahrhaft ist, wird als Kleie an die Schweine verfüttert.
Das Mehl, das heute für Brot, Brötchen, Backwaren, Nudeln, Pizzas usw. verwendet wird, ist fast ausschließlich weißes Weizenmehl. Auch Mehl aus Roggen 15 und Dinkel (eine der vielen Weizenarten) wird verwendet. Dem Weizenmehl beigemischt, macht man daraus sogenannte „Mischbrote“. Bezeichnungen wie „Haferbrot“ oder „Sonnenblumenbrot“ beziehen sich gewöhnlich nur auf Verzierungen des Brotlaibs. Weißes Weizenmehl hat die immer und immer wieder angepriesenen einzigartigen „Backeigenschaften“: Es nimmt Wasser auf und bringt damit Volumen und Gewicht. Es ist formbar. Und es ist haltbarer als jedes andere Mehl.
Die Reste für den Menschen
Die Nahrungsveränderungen des 20. Jahrhunderts betrafen an ersten Stelle Getreide – da es eben das Grundnahrungsmittel Nummer eins war und ist. Die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Gesundheit von Menschen und Tieren wurden in zahllosen Untersuchungen festgehalten 16.
Die klassische Studie stammt von dem Basler Arzt und Zahnarzt Adolf Roos. Sie fand in einem abgeschiedenen Tal in den Schweizer Bergen namens Goms statt. Die Bewohner des Goms lebten bis 1914 weitgehend isoliert von der Außenwelt. Mit der Eröffnung einer Bahnstrecke jedoch setzte ein Wandel von der geschlossenen Selbstversorgung zum offenen Handel ein.
Roos führte den ersten Teil seiner Untersuchung 1930 durch. Die ursprüngliche Nahrung, die hauptsächlich aus Vollgetreide, Frischmilch und Gemüse bestanden hatte, war fast vollständig aus der Ernährung der Gomser verschwunden. (Anzumerken ist hier, dass Kuhmilch grundsätzlich problematisch für den Menschen ist, dass die Kuhmilch, die heute im Supermarkt steht, aber nicht mehr viel mit der von damals zu tun hat.) Die Fette der Getreidekeime und der Milch wurden durch denaturierte (hocherhitzte) Fette ersetzt. Die vollwertige Getreidekost (Brot, Gersten-, Hafer- und Erbsensuppe) wurde von denaturierten Kohlenhydraten (Weißbrot, Weißmehl, Teigwaren, Zucker, Konfitüre) fast vollständig verdrängt. Die Gomser strotzten jedoch immer noch vor Gesundheit und hatten gesunde, schöne Zähne – die Zähne gelten seit jeher als „Spiegel der Gesundheit“.
Das Bild hatte sich jedoch völlig verändert, als Roos 25 Jahre später den zweiten Teil seiner Untersuchung durchführte. Die Leute hatten ihre Kraft und Zähigkeit verloren. Die sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ hatten sich eingeschlichen; und es gab in fast allen Dörfern Karies in verschiedenem Ausmaß.
Ähnliche Ergebnisse brachte ein unfreiwilliges Ernährungsexperiment während des Zweiten Weltkriegs auf Jersey, einer Kanalinsel zwischen England und Frankreich. Die Insel war bis zum Mai 1945, isoliert unter deutscher Besatzung, vollständig auf Selbstversorgung angewiesen. Bald nach dem Waffenstillstand untersuchten die Ärzte Bank und Magee die Bevölkerung auf ihren Gesundheitszustand; und sie waren überrascht, wie gut er war. Ihre Überraschung galt insbesondere dem ausgezeichneten Zustand der Zähne der Kinder.
Der Umstand, dass ein Teil der Kinder während der Kriegsjahre nach England evakuiert worden war, erlaubte eine aufschlussreiche Vergleichsuntersuchung. Die Kinder, die auf Jersey geblieben waren, hatten ein ungleich besseres, zum überwiegenden Teil gar makelloses Gebiss. In der Altersgruppe der Sechs- bis Siebenjährigen hatten nur 19 % der zu Hause Gebliebenen mehr als fünf kariöse Zähne; bei den Evakuierten waren es mehr als 90 %.
Dem deutschen Arzt Werner Kollath gelang es in eindrucksvollen Experimenten, Tiere mit der gewöhnlichen Industriekost so lange am Leben zu halten, bis sie Krankheiten zeigten, die üblicherweise als „Alters-“ und „Abnutzungskrankheiten“ gelten. Bei Ratten dauerte es etwa 2 Jahre - was beim Menschen 50 Jahren entspricht. Er konnte diese Krankheiten durch natürliche Kost verhüten, wobei Vollgetreide die entscheidende Rolle spielte.
Den Rest der Geschichte finden Sie unter dem Thema Gluten in der Nummer 7 dieser Artikelreihe. Er ist verbunden mit dem Lebenswerk von Willem-Karel Dicke.
Die erste Hälfte des letzten Jahrhunderts war sicherlich eine schlimme Zeit; sie brachte aber auch eine Bewegung hervor, die als Lebens- und Ernährungsreform in der Schweiz und Süddeutschland ihren Ausgang nahm. Wir haben ihr eine Menge an wertvoller Literatur zum Thema Ernährung und Gesundheit zu verdanken. Auf sie gehen auch die Reformhäuser und Bioläden zurück, in denen eine Menge an Lebensmitteln erhältlich sind, die für eine vernünftige Ernährung kaum verzichtbar sind – und die die Bezeichnung „Lebensmittel“ tatsächlich verdienen. Vollkornprodukte gehören traditionell dazu. Sogar Kleie – Weizen- und Haferkleie – steht in den Regalen.
Weißes Gold
Zucker war früher - ebenso wie weißes Mehl - ein Luxusgut für Reiche 17. Die einfachen Leute verwendeten eingekochten Traubensaft oder Honig als Süßungsmittel. Zucker wurde aus Indien und Persien importiert. „Weißes Gold“ wurde es gar genannt.
Die Methode der Zuckergewinnung bestand darin, heißen Zuckerrohrsaft mit Klärmitteln (eiweißhaltige Stoffe und Kalk) zu versetzen und in Holz- oder Tonkegel, die Spitze nach unten, zu füllen 18. In der Spitze des Kegels war ein Loch, durch das der Sirup und die Nichtzuckerstoffe herausträufelten, während der Rest kristallisierte und erkaltete. Wenn man den Kegel umdrehte, rutschte der „Zuckerhut“ heraus – und der eine oder andere gelangte auf Segelschiffen nach Europa.
Die Erfindung des Haushaltszuckers
1747 entdeckte der Chemiker Andreas Sigismund Marggraf, dass Zucker auch in der Runkelrübe zu finden ist 17, 18. Also begann man Rüben mit besonders hohem Zuckergehalt zu züchten, und gegen Mitte des 18. Jahrhunderts entstand die Zuckerrübe.
1801 entwickelte Franz Carl Achard die Grundlagen der industriellen Zuckerproduktion, und bald darauf entstand die erste Rübenzuckerfabrik in Cunern/Schlesien. Die industrielle Herstellung lies den Zuckerpreis fallen, und so wurde Zucker bald zum Gegenstand des täglichen Gebrauchs.
Bereits Ende des 19. Jahrhunderts produzierte die Rübenzuckerindustrie weltweit ebenso viel Zucker wie die traditionelle Rohrzuckerindustrie. Ganze Landstriche, bsw. die Magdeburger Börde, wurden mit Zuckerrübenfeldern überzogen. Und da solche Monokulturen viel Dünger brauchen, wurde damit auch die Düngemittelindustrie auf den Weg gebracht.
Heutzutage werden in Deutschland jährlich etwa 2 Millionen Tonnen Zucker abgesetzt. Der durchschnittliche Verbrauch liegt bei etwa 35 kg pro Kopf und Jahr. Das allermeiste davon ist einheimischer Rübenzucker.
Die moderne Zuckerfabrik arbeitet hochrationell.
- Die Zuckerrüben werden gereinigt und zu Schnitzel zerkleinert 18-21. Im Heißwasserstrom wird den Schnitzeln der Zucker entzogen. Es entsteht der noch trübe, dunkle „Rohsaft“ (mit einem Zuckergehalt von etwa 13 bis 15 %). Die Schnitzel werden gepresst, getrocknet und … an die Schweine, vielleicht auch andere Tiere verfüttert.
- Dem Rohsaft wird Kalk und Kohlensäure zugesetzt, die Nichtzuckerstoffe binden. Das Gemisch wird filtriert. Das Filtrat ist der klare, hellgelbe „Dünnsaft“. Der Rückstand, bestehend aus Kalk und gebundenen Nichtzuckerstoffen, wird als Düngemittel verwendet.
- Der Dünnsaft wird durch Verdampfen in mehreren Stufen eingedickt. Zurück bleibt der goldbraunen „Dicksaft“ (mit etwa 65 bis 70 % Zuckergehalt).
- Der Dicksaft wird gekocht, bis sich mit Sirup überzogene Zuckerkristalle bilden: die sogenannte „Füllmasse“ 18, 22.
- Die Abtrennung der Zuckerkristalle erfolgt in hochtourigen Zentrifugen. Die Füllmasse wird geschleudert, die Zuckerkristalle bleiben im Sieb hängen, und der Sirup fließt nach außen ab. Restlicher Sirup wird mittels Wasserdampf von den Zuckerkristallen entfernt, und man ist beim „Weißzucker“ angelangt.
- Indem man den Weißzucker nochmals in Wasser auflöst, kristallisieren lässt und in der Zentrifuge behandelt, erhält man die Raffinade.
- Der abgeschleuderte Sirup wird noch zwei weitere Male aufgekocht und ausgeschleudert. Der übrig bleibende Sirup, nun auch „Melasse“ genannt, ist … für die Schweine, vielleicht auch den Kompost.
Die Raffinade, der übliche Haushaltszucker, wird gern als „weißer Kristallzucker von höchster Reinheit und Qualität“ gepriesen. Das ist chemisch sicher richtig - und seine Herstellung ist großartige Ingenieurskunst. Doch er ist auch so tot, dass er kein Verfallsdatum mehr braucht.
Es gibt in der Zwischenzeit eine Unzahl von Zuckersorten 17, 18, 21. Bei den meisten handelt es sich jedoch nur um verschiedene Formen der Raffinade. Dazu gehören Staubzucker, Puderzucker, Grießzucker, Hagelzucker, Würfelzucker, Zuckerhut (früher die übliche Handelsform von Zucker, heute fast nur noch für die Feuerzangenbowle verwendet), Einmachzucker (gröberer Kristallzucker, der sich relativ langsam auflöst, was eine Schaumbildung verhindert) sowie flüssiger Zucker (in Wasser gelöster Kristallzucker; häufig in der Lebensmittelindustrie verwendet).
Andere Zuckersorten sind Zwischenprodukte der Zuckerherstellung, Mischungen daraus oder anderweitige Verarbeitungen. Dekorierzucker ist feinster Puderzucker, mit Fett oder Stärke versetzt, der sich auch bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht auflöst. Gelierzucker besteht aus Raffinade, Zitronensäure und Apfelpektin (Pektin: vom grch. „pektos“, fest: gelierender Pflanzenstoff); Reste von Früchten werden damit in Marmeladen, Konfitüren und Gelees haltbar gemacht. Vanillezucker ist eine Mischung aus Kristallzucker und Vanillemark. Verwendet man den künstlichen Aromastoff Vanillin, wird Vanillinzucker daraus.
Karamell erhält man, wenn man Zucker trocken erhitzt 23, 24. Kristallzucker beginnt bei etwa 135 °C zu schmelzen, jedoch noch ohne sich zu verfärben. Der entstehende „schwache Bruch“ wird in der Konditorei für glasierte Früchte oder Spinnzucker (auch „Zuckerwatte“) verwendet. Die eigentliche Karamellisierung, verbunden mit farblichen und geschmacklichen Veränderungen, beginnt bei 143 °C. Goldbrauner Karamell, der „starke Bruch“, braucht Temperaturen zwischen 143 und 160 °C. Erkaltet hat er eine glasartige, brüchige Konsistenz (daher „Bruch“). Karamell wird für die Herstellung von Bonbons, Krokant (Mischungen aus gehackten Nüssen und Karamell), Gebäck und Desserts verwendet. Auf Jahrmärkten werden gebrannte Mandeln damit hergestellt. Bei Temperaturen über 160 °C entsteht dunkler, kaum noch süßer Karamell, genannt Zuckercouleur. Er wird in der Lebensmittelindustrie als Farbstoff verwendet.
Unter „Sirup“ versteht man zunächst eine dickflüssige, konzentrierte Lösung, die durch Eindampfen aus zuckerhaltigen Flüssigkeiten wie Zuckerrübensaft, Zuckerrohrsaft oder Fruchtsäften gewonnen wird 25. Sirup fällt als Zwischenprodukt der Zuckerherstellung an. Zuckerrübensirup (auch „Sehm“, „Rübenkraut“, „Rübensaft“, „Rübensirup“ oder „Wurzelkraut“) wird hergestellt, indem man alle löslichen Stoffe der Rübe extrahiert, den Saft filtert und weiter einkocht, bis ein Sirup mit einer Mindesttrockensubstanz von 78 % entsteht, der bei Zimmertemperatur streichfähig ist 26.
Kandiszucker entsteht durch langsames Auskristallisieren aus Zuckerlösungen. Weißer Kandiszucker wird aus hellem Zuckersirup hergestellt; um braunen Kandiszucker zu erhalten, wird karamellisierter Zucker hinzugefügt.
Brauner Zucker ist ein Sammelbegriff für braune Zuckersorten. Es gibt verschiedene Herstellungsverfahren. Entweder Kristallzucker wird mit braunem Zuckerrübensirup gemischt; oder der Zucker wird aus braun gewordenem (teilweise karamellisiertem) Sirup oder aus Mischungen von weißem und braunem Sirup herauskristallisiert.
Vollzucker ist der getrocknete Saft der Zuckerrübe, das heißt getrockneter Zuckerrübensirup. Nichts außer Wasser wurde entfernt, nichts wurde hinzugefügt. Er wurde nur getrocknet und pulverisiert. Das Pendant des Zuckerrohrs ist der Vollrohrzucker, der getrocknete Saft des Zuckerrohrs (auch „Ursüße“ oder „Sucanat“ genannt).
Hier sind also die naturbelasseneren Alternativen. Sie werden gewöhnlich „schonend“, bei niedrigen Temperaturen hergestellt. Sie sind löslich wie gewöhnlicher Haushaltszucker; haben im Unterschied zu diesem aber einen volleren, karamellartigen Geschmack. Sie sind allerdings mehr oder weniger bräunlich, verklumpen leicht und sind nur begrenzt haltbar – was ja die Eigenschaften waren, die Anlass zur „Verfeinerung“ gaben.
Melasse ist der dunkle Sirup am Ende der Zuckerherstellung, dem kein weiterer Zucker mehr entzogen werden kann 27. Die Zuckerrübenmelasse findet vor allem als Viehfutter Verwendung. Heutzutage wird sie zusammen mit den ausgelaugten Rübenschnitzeln zu kleinen Scheiben („Pellets“) gepresst. Die Melasse aus der Herstellung von Rohrzucker wird auch zu Rum verarbeitet.
Da Melasse aber nichts anderes ist als zuckerreduzierter Sirup, handelt es sich dabei um das Beste aus der Zuckerrübe bzw. dem Zuckerrohr. Sie hat allerdings einen eigenartigen Geschmack, weshalb sie sich nicht als Süßungsmittel eignet, sie ist vielmehr eine großartige Nahrungsergänzung.
Forbes Ross wirkte zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Arzt in London 28. Er beklagte die hohe Zahl der Krebstoten bei herkömmlichen Behandlungen mit operativen Eingriffen und Bestrahlungen und versuchte stattdessen, Krebs mit naturheilkundlichen Mitteln zu behandeln. Er befasste sich insbesondere mit den hoffnungslosen Fällen, die nicht operiert werden konnten, oder mit denjenigen, die Operationen oder Bestrahlungen ablehnten. Dennoch war er erstaunlich oft erfolgreich.
Ross hatte beobachtet, dass die Arbeiter auf den Zuckerrohrplantagen der Karibischen Inseln fast nie an Krebs erkrankten; und er hatte das damit in Zusammenhang gebracht, dass die Arbeiter die ganze Zeit auf Zuckerrohrhalmen herumkauten. Zuckerrohr ist reich an Kaliumsalzen (Verbindungen des Kaliums); und Ross war einer der ersten, der Kaliummangel als Schlüsselfaktor bei der Entstehung von Krebs erkannte. Kalium spielte daher die entscheidende Rolle bei seiner Behandlung und Vorsorge.
Ein gewisser Cyril Scott veröffentlichte 1940 ein Büchlein über die Zuckerrohrmelasse, das 1972 in deutscher Übersetzung erschien (Scott 1996). Die Übersetzung trägt den Titel: „Das schwarze Wunder – rohe schwarze Zuckerrohr-Melasse – eine natürliche Wundernahrung“. Der Autor berichtet darin über Behandlungserfolge mit der „Melasse-Therapie“ bei Krebs, Krampfadern, Arthritis, Geschwüren, Hautentzündungen und -ausschlägen, Schuppenflechte, hohem Blutdruck, Angina Pectoris („Brustenge“), Herzschwäche, Verstopfung, Darmentzündung, Schlaganfällen und mancherlei mehr.
Cyril Scott war ein genialer Mann, ein überaus erfolgreicher Musiker und Schriftsteller. Er hatte offensichtlich verstanden, was Forbes Ross erkannt hatte: dass viele der sogenannten „Zivilisationskrankheiten“ des Menschen nur Auswirkungen seiner veränderten Ernährungsgewohnheiten sind. Er hat diese Erkenntnis mit seinem Buch vor der Vergessenheit bewahrt. Und wir haben es ihm zu verdanken, dass wir rohe, schwarze Zuckerrohrmelasse heute im Reformhaus kaufen können – im übrigen das beste Haarpflegemittel überhaupt (einen funktionstüchtigen Darm vorausgesetzt).
Zucker - Aufbau
„Zucker“ und „Kohlenhydrate“ sind in der Chemie Synonyme 29. Kohlenhydrate (aus Kohlenstoff + Hydrat: vom grch. „hydor“, Wasser; Wortbildungselement mit der Bedeutung „Wasser“) sind aus Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) bestehende Verbindungen.
Die einfachsten Kohlenhydrate sind Monosaccharide (vom grch. „mono-“, einfach- + lat. „saccharum“, Zucker; das vom gleichbed. grch. „sakcharon“; auch „Einfachzucker“). Einfachzucker besteht aus einzelnen Molekülen mit der (allgemeinen) Summenformel (CH2O)n mit n = 3 bis 7. (Jeder Teil der Formel ist also mit einem spezifischen n zu multiplizieren.)
Beispiel: n = 6; die Summenformel ist C6H12O6.
Die häufigsten Einfachzucker sind Glucose (über das gleichbed. frz. „glucose“; das vom grch. „glykos“, süß; auch „Traubenzucker“ [oder „Blutzucker“]) und Fructose (vom lat. „fructus“, Frucht + -ose: verkürzt aus „Glucose“; Wortbildungselement mit der Bedeutung „Zucker“; auch „Fruchtzucker“). Beide haben die Summenformel C6H12O6 (aus dem obigen Beispiel); weisen aber unterschiedliche Strukturen auf (siehe Abbildungen 2 und 3). Glucose und Fructose kommen in allen Früchten vor.
Abb. 2: Strukturformel von Glucose.
Abb. 3: Strukturformel von Fructose.
Ein Zuckermolekül mit 5 oder mehr C-Atomen kann einen Ring bilden (siehe Abbildung 4). Zwei solcher ringförmiger Zuckermoleküle können sich mittels einer Sauerstoff-Brücke unter Abscheidung von Wasser zu einem Disaccharid (grch. „di-“, zwei, doppelt; auch „Doppelzucker“) verbinden. (Wenn Sie die Pfeile umdrehen, haben Sie den Vorgang bei der Verdauung,)
Abb. 4: Bildung eines Doppelzuckers.
Ein häufiges Disaccharid ist Maltose (vom lat. „maltum“, Malz + -ose; auch „Malzzucker“). Jeweils zwei Moleküle Glucose sind miteinander verknüpft. Maltose ist z. B. in Getreide enthalten. Ein anderes häufiges Disaccharid ist Saccharose 30. Jeweils ein Molekül Glucose ist mit einem Molekül Fructose verknüpft. Saccharose kommt in Früchten und Gemüse, insbesondere im Zuckerrohr und in der Zuckerrübe, vor – und wird nach obigem Verfahren als „Haushaltszucker“ isoliert.
Eine weitere Zusammenlagerung von Monosacchariden führt zu Oligosacchariden (vom grch. „oligos“, wenig; wenige, ein paar + Saccharid; auch „Mehrfachzucker“). Ein Beispiel ist die Raffinose, ein in Pflanzen vorkommender „Dreifachzucker“ (aus drei Einfachzuckern bestehend). Einfachzucker, Doppelzucker und Mehrfachzucker schmecken süß und sind leicht in Wasser löslich. Sie werden als „Zucker“ im engeren Sinne bezeichnet.
Polysaccharide (vom grch. „polys“, viel; viele + Saccharid; ; auch „Vielfachzucker“) können aus Hunderten und Tausenden verschiedener Einfachzucker bestehen. Hierzu zählt die Stärke, wie sie in Getreide, Kartoffeln oder Gemüse enthalten ist. Sie ist geschmacksneutral, kaum in Wasser löslich, aber gut verdaulich – und der eigentliche Energielieferant für den Organismus. Zu den Polysacchariden gehört auch die Cellulose (vom lat. „cellula“, Verkleinerungsform von „cella“, Zelle + -ose): der Hauptbestandteil der pflanzlichen Zelle. Sie besteht aus mehr als 10.000 Zuckereinheiten. Sie ist für den Menschen unverdaulich, spielt aber eine wichtige Rolle als Ballaststoff.
Zucker - Abbau
Die Verdauung der Kohlenhydrate beginnt bereits im Mund 31. Der Speichel enthält ein Enzym aus der Gruppe der Amylasen (vom grch. „amylon“, Stärke + -ase, Wortbildungselement mit der Bedeutung „Enzym“), das Vielfachzucker in Form von Stärke in kleinere Einheiten spaltet.
Der größere Teil der Stärke wird jedoch im Dünndarm abgebaut. Amylasen werden zu diesem Zweck auch in der Bauchspeicheldrüse und in der Dünndarmwand gebildet. Maltasen (vom lat. „maltum“, Malz + -ase) und Glycosidasen zerlegen die Doppelzucker Maltose und Saccharose in die Einfachzucker Glucose und Fructose.
Doppelzucker und Einfachzucker, die bereits als solche in der Nahrung enthalten sind, brauchen entsprechend weniger an enzymatischer Spaltung. Vielfachzucker in Form von Glycogen („tierische Stärke“), der mit tierischer Nahrung in den Verdauungstrakt gelangt, wird ähnlich abgebaut. Sowohl Stärke wie auch Glycogen bestehen letztlich nur aus Glucose-Einheiten.
Was an Kohlenhydraten verdaulich ist, wird ausschließlich als Einfachzucker, in erster Linie Glucose, ins Blut aufgenommen. Die Funktion unverdaulicher Kohlenhydrate (Ballaststoffe) besteht darin, dem Nahrungsbrei Volumen zu geben und damit zu einem Sättigungsgefühl beizutragen, die Darmwand zu reinigen und die Darmperistaltik aufrechtzuerhalten (Peristaltik: vom gleichbed. grch. „dynamis peristaltikos“, umfassende, zusammendrückende Kräfte: von den Wänden muskulöser Hohlorgane ausgeführte Bewegung, bei der sich Organabschnitte nacheinander zusammenziehen und entspannen, wodurch der Inhalt des Hohlorgans fortbewegt wird).
Der menschliche Körper braucht durchaus Einfach- und Doppelzucker 30, 32. In natürlicher Nahrung kommt er jedoch nur in kleinen Mengen und immer verbunden mit anderen Stoffen vor: Mineralstoffen (in großen Mengen „Mengenelemente“, in kleinen Mengen „Spurenelemente“), Vitaminen, anderen Vitalstoffen (den Vitaminen ähnliche „sekundäre Pflanzenstoffe“) und Ballaststoffen.
Wenn man natürliches Obst isst, gelangt der Zucker nach einer raschen Magenpassage in den Dünndarm. Dort wird er langsam durch die Darmwand ins Blut aufgenommen. Er gelangt über die Pfortader zur Leber 33, wo Fructose zu Glucose umgebaut wird; und die Leber gibt die Glucose kontrolliert in das ableitende arterielle System ab.
Sollte es einen Glucose-Überschuss geben, so speichert ihn die Leber in Form von Glycogen, der konzentrierten Form der Glucose. Glycogen-Depots werden auch in anderen Körperzellen, insbesondere Muskelzellen, unterhalten, um im Bedarfsfall darauf zurückzugreifen. Gleichzeitig gibt die Bauchspeicheldrüse Insulin ab, das die Glucose in die Zellen transportiert, wo sie dem Stoffwechsel zugeführt wird.
Ein Abfall des Blutzuckerspiegels unter den Normalwert ist das Signal für die Bauchspeicheldrüse, ein anderes Hormon, genannt Glucagon, ins Blut zu schicken. Glucagon ist der Gegenspieler des Insulin. Es wandelt Glycogen wieder in Glucose um.
Kohlenstoff ist der Brennstoff der Zellen. Glucose ist die Form, in der er für die Zellen am leichtesten erschließbar ist. Der gesamte Stoffwechselprozess ist komplex und besteht aus mehr als 30 Einzelschritten. Für jeden dieser Einzelschritte ist ein spezifisches Enzym notwendig. Vitamine spielen dabei eine wichtige Rolle als „Co-Enzyme“, das heißt aktivierende Substanzen, ohne die das betreffende Enzym kaum oder gar nicht in Aktion tritt.
Haushaltszucker – eine Spur der Verwüstung
Isolierter Zucker, wie er mengenweise in Schokolade, Schokoriegeln, Bonbons, Speiseeis, Keksen, Gebäck, Kuchen, Torten, Marmeladen, Gelees, Getränken und allem Möglichen verarbeitet wird, setzt ein ganz anderes Szenario in Gang 32. Kohlenhydrate, die sich in Belägen auf den Zähnen niederlassen, werden von Bakterien der Mundflora abgebaut. Dabei entstehende Säuren greifen den Zahnschmelz an und führen zu Zahnfäule („Karies“).
Natürliche Kohlenhydrate in natürlichen Mengen sind kein Problem 30, 32. Der Körper ist darauf eingestellt. Der Speichel ist leicht basisch und neutralisiert die Säuren (Basen und Säuren neutralisieren sich gegenseitig.). Isolierter Zucker und isolierte Stärke in riesigen Mengen jedoch sind nicht auf diese Weise kontrollierbar. Die Zahnbeläge stammen in erster Linie von den Klebereiweißen, die gewöhnlich mit der isolierten Stärke mitgeliefert werden (das sind ja die beiden Bestandteile von weißem Mehl). Auf diese Weise sind die Zähne meist ruiniert, noch bevor die Menschen erwachsen sind – was dann unter allerlei Zahnersatz kaschiert wird.
Isolierter Zucker als Bestandteil der üblichen Nahrung nährt schmarotzende Pilze im Dünndarm. Pilze dieser Art, zusammen mit Alkohol, Nikotin und Medikamenten, können die Darmflora in kürzester Zeit zugrunde richten. Sie produzieren mit ihren Ausscheidungen Blähungen und übel riechende Winde – die aber kaum bemerkt werden, weil man sie als normal ansieht.
Der im Dünndarm vorhandene Doppelzucker verlangt nach Maltasen (siehe oben), um in Einfachzucker gespalten zu werden 32. Maltasen werden in der Leber mittels Vitamin B1 und Mangan gebildet. Beides ist sowohl in der Zuckerrübe als auch im Getreidekorn vorhanden, nicht jedoch in isolierten Kohlenhydraten. Die Leber muss es sich irgendwoher beschaffen. Mangan wird auch in der Insulin produzierenden Bauchspeicheldrüse benötigt. Ein Mangel an Mangan bedeutet daher auch einen Mangel an Insulin; und zu wenig Insulin kann den Blutzuckerspiegel gefährlich steigen lassen. Natürlich fehlt auch das Vitamin B3. Das ist notwendig, um die Maltasen überhaupt zu aktivieren. Hier kann sich der Körper behelfen, in dem er B3 aus der Aminosäure (Eiweißbaustein) Tryptophan herstellt. Tryptophan fehlt dann jedoch für die Herstellung von Serotonin (ein Überträgerstoff des Gehirns, der elektrische Impulse vom einen Nerv zum anderen überträgt). Die Aktivität des Serotonins, bestehend in der Aktivierung bestimmter Hirnareale, geht jedoch mit angenehmen Gemütszuständen einhergeht. Ein Mangel an Serotonin führt daher leicht zu schlechter Laune, Angst oder Depressionen.
Die Darmwand wird bei derartiger Kost wahrscheinlich von Klebereiweißen beschichtet sein. Was jedoch an Zucker die Darmwand passiert, gelangt sehr schnell ins Blut; und da es gewöhnlich ungeheure Mengen sind, die an isolierten Kohlenhydraten in Semmeln, Brot, Gebäck, Nudeln usw. enthalten sind, sind es auch ungeheure Mengen an Zucker, die sehr schnell absorbiert werden. Die Leber kann solche Mengen nicht bewältigen. Sie wird möglicherweise anschwellen - bei ihren Versuchen, etwas davon in Form von Glycogen zurückzuhalten. Den Rest wird sie unkontrolliert ins Blut abgeben. Es erfolgt eine Art Zuckerschock.
Eine Überzuckerung des Bluts stellt eine akute Gefahr für den Organismus dar. Er wird versuchen, Zucker über die Nieren loszuwerden; und so kann es zu einer Entwässerung kommen, die sich durch Wasser trinken allein nicht mehr ausgleichen lässt. Deshalb schüttet die Bauchspeicheldrüse mengenweise Insulin aus. Das Insulin veranlasst Transportproteine in der Zellwand, den Zucker in die Zelle aufzunehmen. Dort läuft ein Feuerwerk ab. Der Mensch fühlt sich aufgeputscht. Das ist der Zuckerschub.
Die hohe Insulinpräsenz jedoch lässt das Feuerwerk rasch verlöschen; und sie führt dazu, dass kaum noch Zucker im Blut vorhanden ist. Das Ergebnis ist eine Unterzuckerung: eine ebenso ernsthafte Gefahr. Die Zellen brauchen ständig Glucose; und es sind insbesondere die Nervenzellen, die darauf angewiesen sind. Daher werden bei jeder Unterzuckerung ein paar Organ- und insbesondere Nervenzellen absterben.
Glucagon ist für solche Notfälle möglicherweise zu langsam. Deshalb springt die Nebennierenrinde ein. Sie schüttet das Hormon Adrenalin aus, das dafür bekannt ist, den Körper zu Höchstleistungen zu veranlassen. Das Adrenalin sorgt für eine hektische Freisetzung von Glucose in den Glycogen-Depots des Organismus.
Isolierte Kohlenhydrate sind leere Kohlenhydrate. Deshalb essen die Leute etwas, was fast ausschließlich aus Kohlenhydraten und Klebereiweißen besteht, und wenig später haben sie schon wieder Hunger. Der Hunger ist nur so lange gestillt, wie der Magen voll ist. Er ist wieder da, sowie sich herausstellt, dass die meisten der erwarteten Nahrungsbestandteile fehlen. So essen die Leute den ganzen Tag. Der Darm ist voll und träge, doch sie schieben noch einen Hamburger hinterher, noch eine Leberkässemmel, noch einen Schokoriegel ...
Überzuckerung und Unterzuckerung wechseln sich auf diese Weise ab. Der Mann isst zum Frühstück zwei frische Semmeln aus reinstem Weizenauszugsmehl mit Butter aus Kuhmilch und Marmelade, bestehend zu 50 % aus Kristallzucker. Dazu gibt es einen Kaffee, denn „ohne Kaffee geht gar nichts“. Er ist dann einigermaßen wach. Zwei Stunden später hat er aber einen Durchhänger, und er würde am liebsten wieder ins Bett gehen. Das lässt sich aber nicht einrichten. Also muss er sich quälen. Wohin wird die Achterbahnfahrt gehen?
Der Körper hat nun ein weiteres Problem: Wohin mit all dem Zucker? Leber- und Muskelzellen können nur begrenzte Mengen an Zucker in Form von Glycogen speichern. Der Rest muss in Fett umgewandelt und im Bindegewebe gelagert werden. Das ergibt unansehnliche Fettpolster am Bauch, an den Oberschenkeln oder wo auch immer. Das Fett kann sich auch in den Spalträumen zwischen den inneren Organen ablagern. (Sie werden von doppelschichtigen Häuten gebildet, die natürlicherweise nur soviel Flüssigkeit enthalten, dass sich die Organe gegenseitig verschieben können.) Und so werden die Leute immer dicker - und sind doch am Verhungern. Unter den chronisch Untergewichtigen sind wahrscheinlich diejenigen zu finden, deren Ernährung zum großen Teil aus Süßigkeiten besteht – und vor allem ihren Darmpilzen dient.
Kalorien zählen und damit die Kohlenstoffzufuhr einschränken hat wenig mit dem Problem zu tun. Es ist nur eine weitere Tortur für den Organismus. Er versucht die ganze Zeit, an Lebensmittel zu kommen. Sie sehen so aus wie Lebensmittel, sind aber meist keine. Deshalb ist er die ganze Zeit hungrig - und nun soll er auch noch weniger davon essen. Was für ein Unsinn!
Die „Kalorie“ (vom lat. „calor“, Wärme) ist eine alte physikalische Maßeinheit. Sie wird für diejenige Energiemenge verwendet, die 1 kg Wasser um 1 ºC (von 14,5 auf 15,5 ºC bei atmosphärischem Druck auf Meereshöhe) erwärmt. Das Problem ist gewöhnlich aber nicht die Energiemenge, die in den Kohlenhydraten, Fetten oder Eiweißen steckt. Das Problem besteht gewöhnlich darin, dass sie dem Körper als isolierte, denaturierte, inkompatible Stoffe verabreicht werden.
Noch ein weißes Gold
Die Rede ist vom Salz. Im engeren Sinn verstehen wir darunter jenen weißen Stoff mit dem Geschmack, den wir „salzig“ nennen (siehe die Nummer 3 dieser Artikelreihe). In der Chemie heißt der Stoff Natriumchlorid (auch „Kochsalz“). Er besteht aus Natrium und Chlor, kommt in der Natur aber nur vermischt mit einer Reihe ähnlicher Stoffe vor. Im weiteren Sinne verstehen wir darunter alle Verbindungen, die wie Natriumchlorid nur relativ locker miteinander verbunden und meist in Wasser löslich sind. Im folgenden sprechen wir von Salz im engeren Sinne.
Ein Geschenk der Natur
Die Menschen wissen schon seit sehr langer Zeit, dass es sich gut als Konservierungsstoff eignet. Vielleicht fanden sie irgendwann einmal an irgendeiner Küste mit Salz überzogene tote Fische, die auf diese Weise konserviert worden waren 34. Jedenfalls gewannen sie Salz aus Meerwasser oder Wasser aus Solequellen (Sole: aus dem gleichbed. niederdeutschen „sole“: salzhaltiges Wasser), das sie in Keramikgefäße füllten und in Öfen zum Sieden brachten 35. Das Wasser verdampfte, und das Salz blieb zurück. Natürlich ging mit seiner Verwendung als Konservierungsstoff auch seine Verwendung als Geschmacksstoff einher. Die Römer führten das Sieden von Sole in Pfannen aus Eisen oder Blei in Europa ein. Das Verfahren wurde im Prinzip bis ins 20. Jahrhundert beibehalten.
Während Salz in früheren Zeiten hauptsächlich als Konservierungs- und Geschmacksstoff verwendet wurde, hat man in der Zwischenzeit zahllose weitere Verwendungsmöglichkeiten, insbesondere als Industriesalz, Auftausalz und Gewerbesalz, gefunden 36-39.
Heute werden in Deutschland 80 % des gewonnenen Salzes als Industriesalz genutzt. Das meiste wird zu Düngemitteln verarbeitet. Was den Rest betrifft, so interessiert allein das Natriumchlorid, als Ausgangsstoff für eine Vielzahl von Substanzen. Ein Teil davon wird für die Herstellung von Soda verwendet. Soda ist eigentlich ein natürliches Mineral. Es wird benötigt, um Textilien zu färben und bleichen und Wasch- und Reinigungsmittel sowie Glas herzustellen. Seit es dem französischen Arzt und Naturforscher Nicolas Leblanc gelungen ist, Soda auf der Basis von Kochsalz herzustellen, ist es möglich, Soda in großen Mengen zu produzieren. Natriumchlorid wird auch mithilfe von elektrischen Strom in seine Bestandteil Natrium und Chlor zerlegt. Natrium wird verwendet, um Natronlauge herzustellen. Papier, Watte und viele weitere Produkte entstehen mithilfe von Natronlauge aus Holz. Die Natronlauge trennt dabei den Hauptbestandteil von Holz, die Zellulose, von unerwünschten anderen Stoffen. Natronlauge ist aber auch die Basis für Seife und Reinigungsmittel. Man braucht sie in der Textilindustrie zur Veredelung der Baumwolle, bei der Keramikherstellung, bei der Aluminiumherstellung usw. Chlor ist der Grundstoff für Lösungsmittel, Desinfektionsmittel, Sprengstoff, Feuerlöschmittel usw. Aus der Verbindung von Chlor und Kohlenstoff entsteht Vinylchlorid, seinerseits Ausgangspunkt für Polyvinylchlorid, kurz PVC: den Allerweltskunststoff für Folien, Einkaufstüten, Joghurtbecher, Verpackungen, Kreditkarten, Fensterrahmen, Rollläden, Autoteile, Billigschuhe, Billigkleidung und alles Mögliche.
12 % des Salzes finden Verwendung als Auftausalz. Man streut es im Winter auf Straßen und Gehwege.
5 % werden als Gewerbesalz verwendet. Es dient - nach wie vor – der Konservierung von Fleisch, Fisch und Gemüse. Es wird immer noch in der Fischerei verwendet, um den Fang frisch zu halten. Man mischt es neuerdings ins Viehfutter, um den Appetit der Masttiere zu anzuregen. In der Medizin nutzt man Salz für stärkende Infusionen (dazu weiter unten mehr).
Es sind ganze 3 %, die als Speisesalz auf den Tisch kommen oder in der Lebensmittelindustrie verarbeitet werden 40.
Alles Leben kommt aus dem salzigen Wasser der Meere; und die Meere sind heute noch der größte Lebensraum der Erde. Der Salzgehalt der Meere ist unterschiedlich 41, 42. In der Ostsee sind es zwischen 0,2 und 2 %, in der Nordsee 3 %, im Mittelmeer 3,8 %, im Toten Meer 28 %. Der durchschnittliche Salzgehalt beträgt 3,5 %. Er hängt ab von den Einträgen der Flüsse und den Emissionen der Erdkruste, von dem, was in die Atmosphäre verdunstet und was vom Meeresboden absorbiert wird. Doch was immer der Gesamtsalzgehalt eines Meers ist, die verhältnismäßige Zusammensetzung aus den verschiedenen Meeressalzen ist überall dieselbe (siehe Abbildung 5). Das Prinzip der konstanten Proportionen gilt unabhängig vom Gesamtsalzgehalt des jeweiligen Meeres 41-44.
Abb. 5: Die Bestandteile von Meersalz (die verschiedenen "Meersalze"). Massenangaben pro 1 kg Meerwasser. 41
Die Meere enthalten all diese Stoffe in gelöster Form. Das ist das wässrige Milieu, in dem sich das Leben auf der Erde entwickelt hat. Chlor und Natrium sind die Hauptbestandteile von Meersalz; und sie sind die wichtigsten anorganischen Stoffe für Menschen und Tiere. Verschiedene Elemente werden in verschiedenen Mengen gebraucht. Die Wichtigkeit von Spurenelementen jedoch, die nur in verschwindend kleinen Mengen benötigt werden, zeigt sich, wenn sie fehlen. (Pflanzen haben einen anderen Stoffwechsel und somit auch andere Prioritäten. Hier stehen Stickstoff, Phosphor und Kalium an erster Stelle.)
Meersalz scheint auf den ersten Blick ein ideales Lebensmittel. Doch die Meere dienen seit Jahrtausenden als Abwassersammelbecken; und die Menschen haben in den letzten 100 Jahren mehr Gift und Schmutz aus Industriebetrieben und aus einer mit Produkten dieser Betriebe verschmutzten und vergifteten Umwelt ins Meer geleitet als 5.000 Jahre lang zuvor. Gesunkene Öltanker und havarierte Ölbohrinseln haben immer wieder die Strände verseucht. Altöl aus unzähligen Schiffstanks ist ins Wasser geflossen. Die Abgase von unzähligen Schiffsmotoren legen ihre giftige Fracht täglich auf der Wasseroberfläche ab. Aller Plastikabfall, der nicht irgendwie vernichtet oder wiederverwertet wird, landet letztlich im Meer. Die Ozeane sind riesig, doch irgendwann sind sie verschmutzt – zu verschmutzt, als dass Salz daraus noch genießbar wäre.
Außerdem gibt es verschiedene Definitionen für „Meersalz“. Wenn wir unter „Meersalz“ die Gesamtheit aller im Meerwasser gelösten Ionen bzw. aller daraus kristallisierten Salze verstehen, sind wir wahrscheinlich überrascht, wenn wir erfahren, was in der Schachtel enthalten ist, auf der „Meersalz“ steht 42.
An den Küsten Frankreichs, Spaniens, Portugals und Italiens bsw. wird Meerwasser in den Becken sogenannter „Salzgärten“ verdunstet 45. Die Salzlösung fließt langsam von einem höheren in ein niedrigeres Becken und von dort weiter in das nächste. Die Salzkonzentration steigt von Becken zu Becken, bis schließlich die Sättigungskonzentration für das Salz erreicht ist, von dem am meisten vorhanden ist: Natriumchlorid. Es fällt aus und sinkt auf dem Boden. Für andere Salze, wie bsw. Magnesiumchlorid oder Calciumchlorid, wird keine Sättigungskonzentration erreicht. Sie bleiben im Restwasser. Und das wird entweder nochmals verwendet oder einfach ins Meer geleitet.
Das so erhaltene „Meersalz“ wird meist raffiniert (vom frz. „raffiner“, verfeinern, läutern) 46. Das heißt, es wird „gewaschen“ (mit sauberem Wasser versetzt) und erneut auskristallisiert. In der Zentrifuge wird das Restwasser zusammen mit Verunreinigungen von den Natriumchlorid-Kristallen getrennt.
Anschließend werden die Kristalle getrocknet und vermahlen. Um Verklumpungen zu verhindern, werden Rieselhilfen zugesetzt: bsw. Calciumcarbonat (eine Verbindung, bestehend aus Calcium, Kohlenstoff und Sauerstoff; auch „Kalk“) oder Magnesiumcarbonat (das gleiche, nur mit Magnesium anstelle von Calcium). Beides sind Salze aus der Kategorie „schwer löslich“ (weshalb sie ja zu diesem Zweck verwendet werden). Auch Aluminiumsilikat (bestehend aus Aluminium, Sauerstoff, Wasserstoff und Silicium) wird eingesetzt. Aluminium ist als wirkungsvolles Nervengift bekannt, das im Gehirn schwer Demenzkranker zu finden ist. All diese Stoffe gelten jedoch in den geringen Mengen, in denen sie verwendet werden, als unbedenklich. (Die Idee selbst geht auf den US-amerikanischen Salzhersteller Morton Salt zurück, der 1911 gut rieselndes Speisesalz auf den Markt brachte; und sie hat sich auch bei uns durchgesetzt.) Weißmacher und weitere Lebensmittelzusatzstoffe runden gewöhnlich ab, was schließlich als „Meersalz“ bezeichnet wird.
Natürliches Meersalz hat sich in unseren Breiten vor etwa 250 Millionen Jahren gebildet 47. Erhebungen der Erdkruste hatten ein flaches Meer vom umgebenden größeren Ozean abgetrennt. „Zechsteinmeer“ nennt man es heute (nach dem „Zechstein“: eben dieser Epoche der Erdgeschichte). Es nahm ungefähr den Raum ein, in dem heute die Nordsee, Dänemark, Holland, Norddeutschland und das nördliche Polen liegen.
Als das Meer austrocknete, erhöhte sich allmählich die Konzentration der im Wasser gelösten Mineralien (die Salze der Erdkruste). Die Lösung ist für jedes Mineral bei einer spezifischen Konzentration gesättigt 48. Wenn weiteres Wasser verdunstet, fällt das Mineral aus und sinkt als Feststoff zu Boden. Für die in größeren Mengen im Meerwasser gelösten Mineralien ist die Sättigungskonzentration als erstes für Calciumcarbonat (CaCO3) erreicht, das sich als Kalk absetzt. Als zweites fällt Calciumsulfat (CaSO4) aus, das eine Schicht aus Gips bildet. Bei weiterer Verdunstung setzt sich Natriumchlorid (NaCl) als Halit (vom grch. „hals“, Salz) ab, gefolgt von (in geringeren Mengen vorkommenden) Edelsalzen. Wenn die Senke schließlich ganz ausgetrocknet ist, trägt der Wind Tonmineralien heran, die eine wasserundurchlässige Schicht aus Ton bilden. Das ganze wiederholte sich mehrmals. Verwerfungen ließen im Laufe der Zeit unregelmäßige Lagerstätten von Halit 49, vermischt mit Edelsalzen, entstehen. Sie werden heute als Steinsalz 47 abgebaut.
Man verwendet zwei Methoden 35. Bei der Bohrlochsolung wird eine vertikale Bohrung in einen Salzstock eingebracht und mit Wasser gefüllt. Die Sole wird zutage gefördert und verdampft. Man erhält Siedesalz. Es besteht hauptsächlich aus Natriumchlorid; Spuren anderer Stoffe können vorhanden sein. Eine gründliche Raffination führt zu einer nahezu vollständigen Isolierung der Natriumchlorid-Kristalle. Letzteres ist, was die Güte von Industrie- und Gewerbesalz ausmacht, da andere Stoffe bei der weiteren Verarbeitung oft störend wirken - und daher als (chemische) Verunreinigungen betrachtet werden. Reines Natriumchlorid wird aufgrund der Gewinnungsmethode auch als Kochsalz bezeichnet. Bei einer Verwendung von Kochsalz als Speisesalz werden entsprechende Zusatzstoffe hinzugefügt: Rieselhilfen und Weißmacher, oft auch Iod (ein Spurenelement, dessen Mangel in der Nahrung zu Erkrankungen der Schilddrüse führen kann).
Der bergmännische Abbau ist die teurere der beiden Methoden. Man bricht Brocken aus dem Salzstock heraus und zertrümmert sie zu kleineren Stücken oder vermahlt sie zu Granulat verschiedener Körnung. Das setzt natürlich voraus, dass der Salzstock keine allzu starken (tatsächlichen) Verunreinigungen aufweist. Salz dieser Art wird oft Ursalz genannt 50. „Es wird nichts weggenommen und nichts hinzugefügt“, heißt es auf einer Packung. (Die Bezeichnung „Kristallsalz“ ist eher unsinnig, da ungelöstes Salz immer in Kristallform vorliegt.) Interessanterweise erhält Vieh derartiges Salz in Form von „Lecksteinen“. Menschen begnügen sich gewöhnlich mit der (billigen) Industrievariante.
Verschiedene Steinsalzlagerstätten weisen natürlich Unterschiede in ihrer Zusammensetzung auf. Das Salz liegt ja schon eine Weile da. Die herausragende Rolle von Chlor und Natrium für den menschlichen Körper jedoch scheint irgendwann überzeugend genug für den Gesetzgeber gewesen zu sein, um eine Mindestmenge von 97 % Natriumchlorid für Speisesalz zu fordern. Anderes Salz darf nicht auf den Markt kommen.
Kochsalz
Die Frage, wie viel „Salz“ ein Mensch braucht, ist von vornherein nicht unbedingt sinnvoll. „Speisesalz“ (Natriumchlorid) ist – ebenso wie „Haushaltszucker“ (Saccharose) - ein Stoff, der in isolierter Form nirgendwo in der Natur vorkommt. Der Mensch braucht weder das eine noch das andere.
Natürliches Salz ist ein Geschenk der Natur. Es enthält eine Menge von Mineralien (Elementen): sowohl Mengen- wie auch Spurenelemente; und es enthält sie in der Form, in der sie für den Körper verwendbar sind 51-53. Doch bereits eine Menge zwischen 0,2 und 1 g genügt, um den täglichen Bedarf zu decken. Der durchschnittliche Verbrauch an Kochsalz hingegen beträgt bei uns zwischen 8 und 20 g pro Tag und Kopf. Das meiste davon ist in vorgefertigter Industriekost enthalten.
Der Körper versucht, das überschüssige Kochsalz loszuwerden. Doch er kann, je nach Alter, Geschlecht und Verfassung, nur etwa 5 g täglich über die Nieren ausscheiden 54, 55. Was im Körper bleibt, wird von Wasserstoff-Molekülen umschlossen. Es wird auf diese Weise isoliert und neutralisiert. Die Reaktion braucht jedoch viel Wasser, so dass es zur Dehydration (vom lat. „de“, von, von .. weg + grch. „hydor“, Wasser: Wasserentzug, Austrocknung) kommen kann. Die mit Wasser ummantelten Ionen jedoch schwemmen den Körper auf. Sie bilden Ödeme (vom grch. „oidema“, Schwellung, Geschwulst: Ansammlungen von Wasser in den Zellzwischenräumen; auch „Wassergewebe“) z. B. unter den Augen oder in den Beinen.
Der Rest wird sich möglicherweise rekristallisieren (lat. „re-“, wieder, zurück: das Salz bildete ursprünglich Kristalle und wird nun wieder zu Kristallen). Die Kristalle können sich mit unverdaulichen Resten tierischer Eiweiße verbinden, z. B. Harnsäure, insofern sie aufgrund überlasteter Nieren nicht ausgeschieden wird. Sie können in dieser Form Gallengrieß, Gallensteine oder Nierensteine bilden oder sich in Gelenken oder Gliedmaßen ablagern, wie bei Arthritis („Gelenkentzündung“) oder Gicht.
Der Körper kann versuchen, etwas davon über die Haut auszuscheiden, was dann zu Hautausschlägen führt. Und weil Natriumchlorid meist nicht das einzige Problem für die Nieren ist, haben wir heute all diese Dialyse-Zentren, in denen menschliches Leben mit Blutreinigungsmaschinen aufrechterhalten wird.
Kochsalz hält den Blutdruck stabil 53. Die dazu notwendige Konzentration im Blut – wie auch in anderen Körperflüssigkeiten - beträgt 0,9 %. Eine Infusion mit 0,9 %-iger Kochsalz-Lösung (0,9 % in Wasser gelöst) wirkt daher stabilisierend bei Mangel- und Erschöpfungszuständen.
Im Falle einer zu hohen Kochsalz-Zufuhr jedoch versucht der Körper, die überflüssige Menge so schnell wie möglich über die Nieren auszuscheiden; und er tut das, indem er den Blutdruck erhöht 56, 57.
Wissenschaftler des Heidelberger Instituts für Pharmakologie haben bereits 2007 den Mechanismus herausgefunden. Im Falle einer zu hohen Kochsalz-Konzentration werden in der Muskulatur der Blutgefäße spezifische Mediatoren (Botenstoffe) gebildet. Sie binden an den dazugehörigen Rezeptoren und lösen über die daran hängende Signalleitung eine Kontraktion der Muskelzellen aus. Der Durchmesser der Blutgefäße verringert sich, und der Blutdruck steigt.
Bluthochdruck zerstört schleichend Herz, Gehirn und Nieren 53. Und nirgendwo in Europa gibt es mehr Fälle von Bluthochdruck als in Deutschland. Bluthochdruck ist die Ursache von Hirnschlägen und Herzinfarkten - und die sind bei uns die Todesursache Nummer eins.
Naturvölker in Südamerika, Papua-Neuguinea und Kenia nehmen weniger als 1 g Salz täglich zu sich; und es gibt keine Probleme mit dem Blutdruck. Die Studien darüber sind ungefähr 50 Jahre alt.
In Finnland hat man in der Zwischenzeit reagiert 53. Man klärt seit 1979 in Medienkampagnen über die Gefahren des exzessiven Verzehrs von Kochsalz auf. Und heute liegt der Salzkonsum um ein Drittel und der Blutdruck der Leute im Mittel um 10 mm Quecksilbersäule (das ist die Maßeinheit hinter bsw. „150 zu 110“) niedriger. Die Sterblichkeit durch Schlaganfälle und Herzinfarkte ist um 80 % gesunken und die Lebenserwartung um fünf bis sechs Jahre gestiegen. So einfach ist das!
Tödliche Hitze
Wenn man Wasser oder Lebensmittel maximal auf Körpertemperatur erwärmt, bevor man sie zu sich nimmt, verringert man dadurch den Aufnahme- bzw. Verdauungsaufwand. In heißen Gegenden der Erde trinkt man daher gern warme Getränke. Lebensmittel werden nicht verändert, wenn man sie nicht über diese Temperatur hinaus erwärmt. Anders verhält es sich, wenn man Lebensmittel erhitzt. Sie verändern dadurch nicht nur Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack - sie werden dadurch auch haltbar.
Die Idee, Lebensmittel durch Erhitzung haltbar zu machen, geht auf Louis Pasteur zurück, der um die Mitte des 19. Jahrhunderts herausfand, dass der Verderb von Lebensmitteln durch Mikroorganismen verursacht wird 58, 59. Darauf basierende Verfahren zielen darauf ab, solche Mikroorganismen - Bakterien, Hefen oder Schimmelpilze - abzutöten. Pasteur wurde damit zum Wegbereiter der Lebensmittelindustrie.
- Beim Pasteurisieren werden flüssige oder breiige Lebensmittel kurzzeitig auf Temperaturen zwischen 60 und 90 °C erhitzt 60, 61. So werden bsw. Milch, Fruchtsäfte, Gemüsesäfte und „Flüssigei“ haltbar gemacht.
- Abkochen von Wasser ist das Erhitzen auf den Siedepunkt. Das Wasser wird mindestens drei Minuten sprudelnd gekocht 63.
- Beim Einkochen wird das zu konservierende Gut gekocht und heiß abgefüllt. Als Einkochgut eignen sich Obst, Gemüse, Pilze, Fleisch und daraus hergestellte Gerichte.
- Ultrahocherhitzung heißt, dass Lebensmittel für einige Sekunden auf 135 bis 150 °C erhitzt werden 62. Man macht das mit Milch („H-Milch“), Fruchtsäften, Dosensuppen, Eintopfgerichten, Sahne und anderen Flüssigkeiten.
Natürlich werden dadurch nicht nur Mikroorganismen, sondern auch die Lebensmittel selbst mehr oder weniger zerstört. Die gekochte Zwiebel schmeckt kaum noch nach Zwiebel, weil es kaum noch eine Zwiebel ist. Geröstete Zwiebelscheiben haben einen anderen Geschmack bekommen, weil durch die Erhitzung neue, künstliche Verbindungen entstanden sind. Die Zwiebel ist in jedem Fall mehr oder weniger denaturiert (vom lat. „de“, von, von … weg; ent- + „natura“, Natur).
Frucht- und Gemüsesäfte
Ganz ohne Hitze geht es aber nicht, wenn Lebensmittel haltbar sein sollen. Frucht- und Gemüsesäfte müssen pasteurisiert werden, es sei denn, man trinkt sie frisch gepresst. Ansonsten würden sie wahrscheinlich zu gären anfangen, noch bevor sie in der Flasche sind.
Nirgendwo auf dem Planeten wird mehr Fruchtsaft getrunken als in Deutschland 64. Die Favoriten sind (nach dem Verbrauch pro Kopf 2009):
- Orangensaft (9,0 L)
- Apfelsaft (8,5 L)
- Multivitaminsaft (4,2 L)
- Traubensaft (1,2 L)
Fruchtsaft ist eigentlich die Zell- und Zwischenzellflüssigkeit von Früchten. Industriell hergestellter „Fruchtsaft“ hat aber oft nur noch wenig damit zu tun V1, 64, 65. Die Früchte werden gewaschen, verlesen und in der Fruchtmühle zerkleinert. Zitrusfrüchte werden wegen der in der Schale enthaltenen Bitterstoffe vorher geschält. Der Obstbrei, die „Maische“, wird gepresst. Der Pressaft wird geschleudert, um Feststoffe, den „Trester“, zu entfernen. Der so erhaltene Saft wird pasteurisiert, danach im Kühltank zwischengelagert.
Um einen zu sauren Geschmack zu „korrigieren“, dürfen gemäß Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung der EU sowohl Fruchtsaft wie auch Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat bis zu 15 Gramm Zucker pro Liter zugesetzt werden (ausgenommen sind Trauben- und Birnensaft) 66. Eine Deklaration im Verzeichnis der Zutaten (auch „Zutatenliste“) ist allerdings erforderlich. Um einen noch süßeren Geschmack zu erzielen, sind bis zu 150 g/L erlaubt. In diesen Fällen ist die Verkehrsbezeichnung (die gesetzlich festgelegte oder allgemein übliche Bezeichnung) „Fruchtsaft“ oder „Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat“ (siehe unten) mit dem Zusatz „gezuckert“ oder „mit Zuckerzusatz“ zu ergänzen. In Deutschland ist es jedoch nicht üblich, Fruchtsaft welcher Art auch immer zu zuckern.
Um den frischen Saft vor Oxidation zu schützen und optisch aufzuhellen wird oft „Vitamin C“ zugesetzt. Üblicherweise handelt es sich hierbei allerdings nicht um echtes Vitamin C, sondern künstlich hergestellte Ascorbinsäure 67. Sie muss allerdings auch als solche deklariert werden.
Bei allem, was an abgepackten oder abgefüllten Lebensmitteln hergestellt wird, sind die verwendeten Zutaten auf der Zutatenliste anzugeben. Es gibt jedoch eine Reihe verwendeter Stoffe, die nicht als Zutaten gelten. Solche Stoffe, Verarbeitungshilfsstoffe (auch „technische Hilfsstoffe“) genannt, erscheinen nicht auf der Zutatenliste. Im Falle von Fruchtsäften und daraus hergestellten Erzeugnissen sind das u. a. Speisegelatine, Bentonit und Tannine.
Speisegelatine ist ein Stoffgemisch aus denaturierten, geschmacks-neutralen tierischen Eiweißen 66, 68, 69. Hauptbestandteil ist Kollagen, der grundlegende Baustoff von Bindegeweben. Speisegelatine wird bei uns zum größten Teil aus Schweineschwarten hergestellt (5 kg Schweine-schwarten ergeben 1 kg Gelatine), zu kleineren Teilen aus Tierknochen und -häuten. Das Material wird gesäubert und zerkleinert. Bei der Herstellung in der Küche wird es gekocht; bei der industriellen Herstellung je nach Art des Materials mit Säuren oder Laugen behandelt. Das Kollagen wird auf diese Weise wasserlöslich. Die Säure bzw. Lauge wird zu Salz neutralisiert (Säuren können mit Laugen und umgekehrt neutralisiert werden). In der so erhaltenen Lösung setzt sich Fett auf der Oberfläche ab, feste Bestandteile sinken zu Boden. Beides wird entfernt. Die Lösung wird mehrmals unter hohem Druck gefiltert, bis sie glasklar ist. Sie wird durch Kunstharz-Granulat (Kügelchen) geleitet, an dem die Salze hängen bleiben. Anschließend wird sie so lange erhitzt, bis das meiste Wasser verdampft ist. Das Konzentrat wird sterilisiert, abgekühlt und durch eine Lochscheibe gepresst. Die so erhaltenen Gelatine-Nudeln werden nochmals mit warmer, steriler Luft getrocknet. Die Nudeln werden zu Gelatine-Pulver vermahlen und gehen in dieser Form an die Kunden. „Und daraus stellen die dann all die schönen, leckeren Dinge her, die uns so froh machen“ (aus einem Werbefilm des Homo sapiens) 69. Oder das Pulver wird wieder in Wasser gelöst und auf eine Kühltrommel aufgetragen. Dadurch entsteht ein Film, der durch Messer in schmale Bänder geschnitten wird. Die Bänder werden getrocknet, in Blätter geschnitten und zur Verpackung weitergeleitet. „Von hier aus tritt die Blatt-Gelatine ihre Reise in die Küchen der Welt an“ 69.
Bentonit (benannt nach der Benton-Formation, einer geologischen Formation in Wyoming, USA) ist ein Gestein, das eine Mischung aus verschiedenen Tonmineralien darstellt 70. Es entsteht durch Verwitterung aus vulkanischer Asche. Bentonit zeichnet sich durch eine außerordentliche Wasseraufnahmefähigkeit auf. Fein vermahlen, wird es auch als Heilerde verwendet.
Tannine: sind natürliche Gerbstoffe von Stauden, Sträuchern und Baumblättern 71, 72. Gerbstoffe haben zusammenziehende, austrocknende Wirkung und zählen zu den „Antinährstoffen“: den Abwehrstoffen der Pflanzen gegen Fressfeinde, da sie leicht zu Verdauungsproblemen führen können. (Weintrauben enthalten Tannine in Stielen, Kernen und Beerenhäuten. Sie verleihen Rotwein seine trockene Note.)
Bei den obigen Stoffen handelt es sich in erste Linie um Schönungsmittel 73. Sie werden Fruchtsaft (und auch Weißwein) zugesetzt, um Trübstoffe zu binden. Sie bilden Flocken, die anschließend aus dem Saft entfernt werden. Sie verlassen also den Saft wieder, zusammen mit den unerwünschten Inhaltsstoffen der Früchte – weshalb sie auch nicht als Zutaten oder Zusatzstoffe gelten.
Der Saft wird anschließend entweder ein zweites Mal erhitzt und als Fruchtsaft in Flaschen gefüllt oder zu Konzentrat eingedampft und später rückverdünnt. Bei Zitrusfrüchten werden Aromen eingefangen, indem man beim ersten Erhitzen den Dampf kondensiert. Das Fruchtfleisch, die „Palpe“, wird in der Zentrifuge abgetrennt, pasteurisiert und eingefroren. Kondensat und Palpe werden dem Konzentrat später teilweise wieder zugesetzt.
Die verwendeten Äpfel stammen meist aus Osteuropa, die Orangen aus Brasilien 65. Die Früchte werden vor Ort gepresst und der Saft auf ein Sechstel bis ein Achtel seines Volumens eingedampft. Konzentrate verschiedener Sorten werden in großen Kühlanlagen gelagert. Ihr Verschnitt ergibt einen auch über längere Zeit konstanten Geschmack. Das Verfahren verringert also nicht nur Transportkosten, sondern ermöglicht auch den spezifischen Geschmack einer Marke.
In Deutschland oder wo auch immer angekommen, wird das Konzentrat in der Saftfabrik mit Trinkwasser aufgefüllt; und wir erhalten Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat. (Die Bezeichnung „Direktsaft“ hat keine rechtliche Relevanz, sie wurde vielmehr von Herstellern eingeführt, um damit zu betonen, dass ihr Saft nicht aus Konzentraten stammt).
Die Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung spricht von „wiederhergestellten Säften“, wenn Konzentrate mit den entsprechenden Mengen an „Trinkwasser“ rückverdünnt wurden 66. Doch man kann solche Säfte sicherlich nicht als „wiederhergestellt“ betrachten, wenn man bedenkt, was ihnen zuvor unwiederbringlich an Stoffen entzogen wurde und dass das ursprünglich in den Früchten enthaltene Wasser durch gewöhnliches Trinkwasser ersetzt worden ist. Wenn das verwendete Trinkwasser aufgrund seines Mineralstoffgehalts belastend für den Körper ist, wird das auch für das damit hergestellte Produkt gelten (siehe dazu die Nummer 3 dieser Artikelreihe).
Fruchtnektar ist ein Erzeugnis, das durch Zusatz von Wasser zu Fruchtsaft („Direktsaft“), Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat oder ähnlichen Erzeugnissen, z. B. getrocknetem Fruchtsaft (Fruchtsaft, dem nahezu das gesamte natürlich enthaltene Wasser entzogen wurde; auch „Fruchtsaftpulver“), entsteht.
Die Fruchtsaft- und Erfrischungsgetränkeverordnung schreibt einen „Mindestgehalt an Fruchtsaft oder Fruchtmark“ im fertigen Erzeugnis für alle gängigen Fruchtsorten vor. (Wenn die Verarbeitung der Frucht weniger zu Saft als zu Brei führt, spricht man von „Fruchtmark“). Der beträgt bsw. für Orangen, Äpfel, Pfirsiche, Ananas, Orangen 50 %, für Bananen, Mangos, Papayas 25 %. „Der Zusatz von Zuckerarten oder Honig ist bis zu höchstens 20 % des Gesamtgewichts des fertigen Erzeugnisses zulässig“.
Fruchtsaftgetränke unterliegen nicht der obigen Verordnung; sie sind vielmehr in Leitsätzen für Erfrischungsgetränke des Deutschen Lebensmittelbuchs beschrieben 74. (Letzteres wird von der Deutschen Lebensmittelbuch-Kommission in mehreren Fachausschüssen ausgearbeitet und vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft veröffentlicht.)
Der Fruchtgehalt soll bsw. mindestens 6 % bei Zitrusfrüchten und mindestens 30 % bei Kernobst und Trauben betragen. Sowohl Zucker wie auch Aromastoffe (siehe unten) dürfen zugesetzt werden.
Dicksaft ist stark konzentrierter, dickflüssiger Fruchtsaft, mit anderen Worten, Fruchtsaftkonzentrat 75-77. Bestimmte Dicksäfte, z. B. Apfel- und Birnendicksaft, werden oft als Süßungsmittel verwendet. Wenngleich Dicksaft im Vergleich zu Sirup eher schonend hergestellt wird, so gehen doch eine Menge an Inhaltsstoffen verloren. Deshalb liegt nun auch der Fruchtzucker in mehr oder weniger isolierter Form vor.
Zur Herstellung von Fruchtsirup werden die Früchte mit etwas Wasser gekocht und auf diese Weise entsaftet 78. Die gesiebte Flüssigkeit wird mit Zucker vermischt, nochmals gekocht und in Flaschen gefüllt. Mit Wasser versetzt, lässt sich daraus ein Fruchtsaftgetränk herstellen. Fruchtsirup ist jedoch aus der Mode gekommen.
„Himbeersirup“ und „Waldmeistersirup“, z. B. zur Herstellung der Berliner Weißen, werden meistens aus konzentrierter Zuckerlösung, Aroma- und Farbstoffen herstellt – sind also kein Fruchtsirup. In der Lebensmittelindustrie ist „Sirup“ ein Synonym für „Konzentrat“ oder „Dicksaft“.
Gemüsesaft ist nach dem Deutschen Lebensmittelbuch „das unverdünnte, zum unmittelbaren Verzehr bestimmte gärfähige und unvergorene oder milchsauer vergorene, flüssige Erzeugnis aus Gemüse“ 79. („Gärfähig und unvergoren“ heißt quasi „nicht vollständig denaturiert“, „milchsauer vergoren“ heißt, dass Zucker teilweise zu Milchsäure abgebaut wurde, z. B. im Sauerkrautsaft.) Gemüsesaft ist auch als Gemüsesaft aus Gemüsesaftkonzentrat erhältlich. Im Gemüsenektar müssen gewöhnlich mindestens 40 % Gemüsesaft enthalten sein. Die Herstellung ist im großen und ganzen mit der Herstellung von Fruchtsaft und Fruchtsafterzeugnissen identisch.
Deklarationspflichtige Zutaten sind Salz, verschiedene Zuckerarten, Essig, Kräuter und Gewürze, Milch-, Wein-, Zitronen- und Apfelsäure sowie der Geschmacksverstärker Glutamat (siehe unten). Zu den „technisch bedingten“ – und nicht deklarationspflichtigen - Verarbeitungshilfsstoffen gehören Amylasen (Enzyme zum Aufbrechen von Zellwänden), Bentonit und Speisegelatine (zur Schönung) und „Vitamin C“ (zur Verbesserung der Haltbarkeit).
Der verlorene Geschmack und die missglückten Lösungsversuche
Wenn man Lebensmittel erhitzt, erhalten sie entweder einen neuen, künstlichen Geschmack (siehe die Nummer 4 dieser Artikelreihe) oder sie verlieren ihren Geschmack. Also werden sie gezuckert, gesalzen, gewürzt und mit allerlei Aromastoffen und Zusatzstoffen versetzt.
Zucker in Form isolierter Saccharose erfreut sich seit 150 Jahren ständig wachsender Beliebtheit. Die Deutschen verbrauchen heute zwischen 33 und 34 kg pro Kopf und Jahr davon 80. Zucker ist so sehr in Mode, dass selbst die rohen Früchte immer süßer werden. Man züchtet süße Äpfel, Orangen, Weintrauben und Ananas. Weintrauben und Ananas sind oft widerlich süß. Sogar Zitronen werden süß, indem man ihnen die Bitterstoffe wegzüchtet.
Je mehr der Zucker in Mode gekommen ist, desto mehr sind gleichzeitig die Bitterstoffe in Vergessenheit geraten. Doch Bitterstoffe regen die Verdauung an und pflegen Magen und Darm 81, 82. Die moderne Ernährung sorgt also nicht nur dafür, dass der Darm mit Klebereiweißen verkleistert wird, sie schließt gleichzeitig diejenigen Stoffe aus, die Abhilfe leisten könnten.
Bitterstoffe finden Sie bsw. in Endivien, Rucola, Radiccio, Chicorée, Artischocken, Broccoli und Rosenkohl. Besonders viel ist in den Schalen von Zitrusfrüchten enthalten. Zitronen- und Orangenschalen, fein geschnitten, lassen sich in kleineren Mengen zur regelmäßigen Darmpflege, in größeren zur gelegentlichen Darmreinigung verwenden.
Haushaltszucker macht jedoch dick; und viele Leute achten auf ihr Gewicht. Für Diabetiker ist es gar lebenswichtig, ihren Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu halten. Für all diese Leute gibt es heutzutage Süßstoffe 83.
Es handelt sich um künstlich hergestellte Ersatzstoffe für Zucker, die dessen Süßkraft so weit übertreffen, dass nur sehr wenig davon gebraucht wird. Sie können aufgrund ihrer chemischen Struktur an den Geschmacksrezeptoren der Zunge anzudocken, haben jedoch keinen oder einen sehr niedrigen physiologischen Brennwert. Mit anderen Worten, sie täuschen Geschmacksempfindungen vor – was den Sinn von Süßstoffen eigentlich von vornherein in Frage stellt. Von „natürlichen Ersatzstoffen für Zucker“ zu sprechen ist sicherlich unsinnig. Es sind einfach andere süße Stoffe, z. B. Stevia.
Süßstoffe oder Süßungsmittel sind Lebensmittelzusatzstoffe und als solche auf der Zutatenliste von abgepackten oder abgefüllten Lebensmitteln – und in einfacherer Form auch bei loser Ware – anzugeben.
Die Geschichte der künstlichen Süßstoffe begann 1878, als an einer Universität der USA ein chemischer Reaktionsansatz außer Kontrolle geriet und überkochte 83, 84. Der Chemiker bemerkte später eine Substanz mit süßlichem Geschmack an seiner Hand – und hatte Saccharin gefunden.
Ähnliche Umstände führten 1937, ebenfalls in den USA, zu Cyclamat 85. Ein Chemiker suchte nach einem fiebersenkenden Mittel, als er bemerkte, dass die Zigarette, die er versehentlich mit seiner neuesten Kreation beträufelt hatte, überraschend süß schmeckte.
Sowohl Saccharin wie auch Cyclamat gerieten immer wieder in den Verdacht, Krebs auszulösen. Saccharin wurde deshalb 1977 in Kanada verboten. Als man dasselbe auch in den USA erwog, regte sich jedoch Widerstand in der Bevölkerung, insbesondere unter den Diabetikern, da Saccharin der einzig verfügbare künstliche Süßstoff war. Also beließ man es dabei, einen Warnhinweis auf Verpackungen von saccharinhaltigen Lebensmitteln vorzuschreiben – den man im Jahre 2000 abschaffte.
Saccharin ist bei uns nur für bestimmte Lebensmittel in bestimmten Höchstmengen zugelassen 85. Dazu gehören u. a.:
- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Getränke (max. 80 mg/L)
- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Desserts (max. 100 mg/kg)
- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Brotaufstriche, Konfitüre, Marmeladen, Gelees (max. 200 mg/kg)
- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Süßwaren auf der Basis von Kakao oder Trockenfrüchten (max. 500 mg/kg)
- süßsaure Obst- und Gemüsekonserven (max. 160 mg/kg)
- süßsaure Fisch-, Meeres- und Weichtierkonserven (max. 160 mg/kg)
- Soßen und Senf (max. 160 bis 320 mg/L)
- Alkoholische Getränke (max. 80 mg/L)
- Knabbererzeugnisse aus Getreide oder Nüssen (max. 100 mg/kg)
- Nahrungsergänzungsmittel (max. 80 – 1.200 mg/kg)
Saccharin wird darüber hinaus in Kosmetika, Arzneimitteln und Futtermitteln eingesetzt.
Cyclamat ist aus dem oben genannten Grund seit 1970 in den USA verboten 86, 87. In der EU ist es wiederum für bestimmte Lebensmittel in bestimmten Höchstmengen zugelassen. Dazu gehören:
- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Getränke (max. 250 mg/L)
- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Desserts (max. 250 mg/kg)
- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Brotaufstriche, Konfitüre, Marmeladen, Gelees (max. 500 bis 1.000 mg/kg)
- energiereduzierte bzw. zuckerfreie Obstkonserven (max. 1.000 mg/kg)
- Nahrungsergänzungsmittel (max. 400 bis – 1.250 mg/kg)
Cyclamat wird außerdem für Kosmetika und Arzneimittel verwendet. Speiseeis, Bonbons und Kaugummis dürfen nicht (mehr) mit Cyclamat gesüßt werden.
Der Geschmack von Zucker lässt sich allerdings weder mit Saccharin noch Cyclamat völlig imitieren. Um geschmackliche Nachteile auszugleichen und eine höhere Süßkraft zu erreichen, werden deshalb oft Mischungen aus Saccharin und Cyclamat und anderen Süßstoffen verwendet 86.
Weder Saccharin noch Cyclamat werden im menschlichen Körper abgebaut 84, 86. Beides wird unverändert wieder ausgeschieden, insofern die Leistungsfähigkeit der Nieren nicht überschritten wird. Letzteres gilt jedoch nicht für einen Süßstoff ganz anderer Art: Aspartam.
Die Geschichte vom Aspartam
Aspartam ist ein weiteres Zufallsprodukt. Der Chemiker James Schlatter fand es im Dezember 1965, als er in einem Labor der Firma G. D. Searle & Company, einem US-amerikanischen Arzneimittelhersteller, nach einem Mittel gegen Magengeschwüre suchte V2, 88.
Im Januar 1970 erhielt Searle das Patent auf Aspartam 89. Im Juli 1974 genehmigte die FDA („Food and Drug Administration“, Lebensmittel- und Medikamentenbehörde der USA) Searle die Verwendung von Aspartam als Süßstoff in Pulver- und Tablettenform für den Gebrauch bei Tisch, in Frühstückszerealien, Getränken, Molkereiprodukten u. ä sowie als Geschmacksverstärker in Kaugummi V2, 90.
Aspartam war jedoch von Anfang an umstritten. John Olney von der Washington-Universität, St. Louis berichtet: „Ich verabreichte jungen Mäusen Aspartam und stellte fest, dass es eine bestimmte Art von Gehirnschaden verursachte … und wenn es ernsthafte Auswirkungen bei Tieren gibt und wenn diese Auswirkungen bei Tieren zweifelsfrei nachgewiesen sind, dann sollte es nicht für den menschlichen Gebrauch zugelassen sein.“ V3
John Olney und Jim Turner – der als Verbraucherschützer schon an dem Verbot von Cyclamat mitgewirkt hatte - legten gemeinsam Widerspruch gegen die Zulassung ein und beantragten einen öffentlichen Untersuchungsausschuss V2, 90, 91. Die FDA entschied im Dezember 1975 nach einer ersten Durchsicht der von Searle durchgeführten Studien, die Zulassung auszusetzen, bis offene Fragen durch den Untersuchungsausschuss geklärt wären V3, 90.
Der Untersuchungsausschuss nahm seine Arbeit auf. Der Vorsitzende und zwei Mitglieder stützten sich auf ein unabhängiges Gutachtergremium. Das stellte bald fest, dass die von Searle vorgelegten Studien eine Katastrophe waren 92. 20 % vom Miserabelsten ließ man deshalb gleich weg. als die Berichte für die Zwecke des Ausschusses abgeschrieben werden mussten. Nun zeigte sich, dass Searle Daten aus notdürftig durchgeführten Studien manipuliert hatte. Darüber hinaus waren es nur Studien, die vom Hersteller selbst finanziert oder kontrolliert worden waren, die Aspartam Unbedenklichkeit bescheinigten. So forderte die FDA zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Untersuchung des Justizministeriums gegen kriminelle Machenschaften eines Herstellers – die schließlich aufgrund von Verjährung eingestellt wurde.
Die von der FDA veröffentlichte Liste der Nebenwirkungen von Aspartam umfasste über 90 Symptome. Die ursprüngliche von H. J. Roberts, der den medizinischen Bericht für den Ausschuss verfasste, enthielt noch einige mehr 93:
- Kopfschmerzen (Headache)
- Schwindel oder Gleichgewichtsstörungen (Dizziness or Problems with Balance)
- Stimmungsschwankungen (Change in Mood Quality or Level)
- Übelkeit und Erbrechen (Vomiting and Nausea)
- Bauchschmerzen und -krämpfe (Abdominal Pain and Cramps)
- Verändertes Sehvermögen (Change in Vision)
- Durchfall und Krämpfe (Diarrhea Seizures and Convulsions)
- Gedächtnisverlust (Memory Loss)
- Müdigkeit und Erschöpfung (Fatigue, Weekness)
- Andere nervöse Beschwerden (Other Neurological)
- Hautausschlag (Rash)
- Schlafstörungen (Sleep Problems)
- Nesselausschlag (Hives)
- Veränderte Herzschlagfrequenz (Change in Heart Rate)
- Juckreiz (Itching)
- Empfindungsstörungen (Taubheit, Kribbeln) (Change in Sensation [Numbness, Tingling])
- Grand-mal-Anfall (Grand Mal)
(frz. „gand mal“, großes Übel: „großer epileptischer Anfall)
- Schwellungen (Local Swelling)
- Antriebsstörungen (Change in Acitivity Level)
- Atembeschwerden (Difficulty Breathing)
- Veränderungen oraler Empfindung (Oral Sensory Changes)
- Veränderungen des Menstruationszyklus (Change in Menstrual Pattern)
- Andere Hautprobleme (Other Skin)
- Anders lokalisierte Schmerzen (Other Localized Pain and Tenderness)
- Andere urogenitale Veränderungen der Körpertemperatur (Other Urogenital Change in Body Temperature)
- Schluckbeschwerden (Difficulty Swallowing)
- Andere stoffwechselbedingte Gelenk- und Knochenschmerzen (Other Metabolic Joint and Bone Pain)
- Sprachschwierigkeiten (Speech Impairment)
- Andere Magen-Darm-Beschwerden (Other Gastrointestinal)
- Schmerzen in der Brust (Chest Pain)
- Andere Störungen des Bewegungsapparats (Other Musculo-Skeletal)
- Ohnmacht (Fainting)
- Halsentzündung (Sore Throat)
- Andere Herz-Kreislauf-Beschwerden (Other Cardiovascular)
- Geschmacksstörungen (Change in Taste)
- Probleme beim Wasserlassen (Difficulty with Urination)
- Andere Atembeschwerden (Other Respiratory)
- Ödem (Edema)
(vom grch. „oidema“, Schwellung: Schwellung des Gewebes aufgrund von Wassereinlagerungen)
- Hörprobleme (Change in Hearing)
- Bauchschwellungen (Abdominal Swelling)
- Veränderter Speichelfluss (Change in Saliva Output)
- Veränderte Urinmenge (Change in Urine Volume)
- Veränderte Schweißabsonderung (Change in Perspiration Pattern)
- Brennende Augen (Eye Irritation)
- Nicht näher spezifizierte Störungen (Inspecified)
- Muskeltremor (Muscle Tremors) (lat. „tremor“, das Zittern)
- Petit-mal-Anfall (Petit Mal)
(frz. „petit mal“, kleines Übel: „kleiner epileptischer Anfall“)
- Veränderte Hungergefühle (Change in Appetite)
- Körpergewichtsveränderungen (Change in Body Weight)
- Nachtaktivität (Nocturnal)
- Veränderungen hinsichtlich Durst oder Wasseraufnahme (Change in Thirst or Water Intake)
- Bewusstlosigkeit und Koma (Unconsciousness and Coma)
- Atemgeräusche (Wheezing)
- Verstopfung (Constipation)
- Andere Extremzustände (Other Extremity)
- Schmerzen (Pain)
- Blutungen (Problems with Bleeding)
- Unsicherer Gang (Unsteady Gait)
- Bluthusten (Caughing Blood)
- Blutzuckerprobleme (Glucose Disorder)
- Blutdruckveränderungen (Blood Pressure Changes)
- Veränderungen von Haut- und Nagelpigmentierung (Change in Skin and Nail Coloration)
- Veränderungen von Haut und Nägeln (Change in Hair and Nails)
- Übermäßige Schleimproduktion (Excessive Phlegm Production)
- Nasennebenhöhenentzündungen (Sinus Problems Simple)
- Partielle epileptische Anfälle (Partial Seizures)
- Halluzinationen (Hallucinations)
- Irgendwelche Beulen oder Knoten (Any Lumps Present)
- Kurzatmigkeit bei Anstrengungen (Shortness of Breath on Exertion)
- Blut in Stuhl oder Erbrochenem (Evidence of Blood in Stool or Vomit)
- Regelschmerzen (Dysmenorrhea)
- Zahnprobleme (Dental Problems)
- Geruchsstörungen (Change in Smell)
- Tod (Death)
- Andere Störungen des Blut- und Lymphsystems (Other Blood and Lymphatic)
- Ekzem (Eczema)
(vom grch. „akzema“, Hautausschlag: entzündliche Hauterkrankung)
- Komplexe partielle epileptische Anfälle (Complex Partial Seizures)
- Geschwollene Lymphknoten (Swollen Lymph Nodes)
- Blut im Urin (Hematuria)
- Kurzatmigkeit infolge der Körperhaltung (Shortness of Breath due to Position
- Schwangerschaftsprobleme (Difficulties with Pregnancy)
- (Bei Kindern) Entwicklungsverzögerung ([Children only] Developmental Retardation)
- Veränderungen hinsichtlich Brustumfang oder Empfindlichkeit (Change in Breast Size or Tenderness)
- Blutarmut (Anemia)
- Sexuelle Störungen (Change in Sexual Function)
- Schock (Shock)
- Bindehautentzündung (Conjunctivitis)
- Geweitete Augen (Dilating Eyes)
- Fieber (Febrile)
Die FDA widerrief die Genehmigung von Aspartam im September 1980 V3, 90. Vernon Young, ein Mitglied des Untersuchungsausschusses, erinnert sich: „Wir rieten dazu, weiter Studien durchzuführen.“ Auch Gere Goyan, der damalige Leiter der FDA, verlangte weitere Studien, durchgeführt von Leuten, die zuvor nichts mit Aspartam zu tun gehabt hatten. Dazu kam es aber nicht mehr - und das hatte vor allem mit einem Mann namens Donald Rumsfeld zu tun V2.
Donald Rumsfeld war Ende der 60-er/Anfang der 70-er Jahre Mitglied der Regierung und des Regierungskabinetts von Richard Nixon 92. Nach Nixons Rücktritt wurde er unter dessen Nachfolger Gerald Ford Stabschef des Weißen Hauses und vom 3. November 1975 bis zum 19. Januar 1977 Verteidigungsminister. Nach der Abwahl von Ford aus dem Präsidentenamt verlor auch Rumsfeld seiner politischen Ämter. Deshalb betätigte er sich während der Amtszeit von Jimmy Carter in der freien Wirtschaft. Und er war von 1977 bis 1985 Vorstandsvorsitzender von G. D. Searle, das 1985 von Monsanto übernommen wurde. Als Ronald Reagan Präsident wurde, kehre Rumsfeld allmählich wieder in die Politik zurück. Reagan war von 1981 bis 1989 Präsident der USA, und Rumsfeld war in dieser Zeit Sondergesandter der USA im Irak (der von 1980 bis 1988 Krieg gegen den Iran führte). Nach der Wahl von George W. Bush zum Präsidenten wurde Rumsfeld 2001 wieder Verteidigungsminister. Nach den Terroranschlägen am 11. September ließ Rumsfeld im Dezember 2001 US-Streitkräfte in Afghanistan einmarschieren. Er war auch einer der stärksten Befürworter der amerikanischen Invasion in den Irak im März 2003. Europäische Staaten, die ihre Unterstützung des Kriegs durch Entsendung von Soldaten verweigerten, bezeichnete er als „Old Europe“. Rumsfeld wurde jedoch zunehmend mit Misshandlungsvorwürfen konfrontiert. Der Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck reichte am 30. November 2004 in Vertretung der US-Menschenrechtsorganisation Center for Constitutional Rights eine Strafanzeige wegen Kriegsverbrechen und Verstößen gegen das Völkerrecht im Irak bei der deutschen Bundesanwaltschaft gegen Rumsfeld ein, was zu Drohungen des Pentagons führte, dass eine juristische Verfolgung eine weitere Belastung der ohnehin schon gestörten Beziehungen zwischen den USA und Deutschland darstellen würde. Generalbundesanwalt Kay Nehm lehnte die Strafanzeige am 10. Februar 2005 mit der Begründung fehlender Zuständigkeit ab. Am 8. November verkündete Präsident Bush den Rücktritt von Rumsfeld als Verteidigungsminister.
1981 wurde Ronald Reagan US-Präsident. Rumsfeld ließ seine Verbindungen spielen, und Reagan ernannte einen neuen FDA-Leiter in Person von Arthur Hull Hayes. Und der erhielt genügend Macht, um sich über alles, was sich zuvor ereignet hatte, hinwegzusetzen und rasch die Zulassung von Aspartam zu genehmigen – zunächst für Trockengerichte und ab 1983 auch für kohlensäurehaltige Getränke V3, 92.
1987 gab es noch eine öffentliche Anhörung zum Thema Aspartam. Doch das Komitee sah keine Notwendigkeit für weitere Studien und ließ Aspartam auf dem Markt. Später stellte sich heraus, das Searle Mitglieder des Komitees dafür bezahlt hatte.
1993 wurde Aspartam auch für sonstige Getränke, Back- und Süßwaren zugelassen 88. Seit 1996 unterliegt Aspartam in den USA keinerlei Beschränkungen mehr – ganz gleich, wie sehr auch immer sich Wissenschaftler, Ärzte, Journalisten und Betroffene darum bemüht haben, den Leuten klar zu machen, was Aspartam im menschlichen Körper macht 91.
G. D. Searle & Company hatte das Patent auf Aspartam erhalten und unter dem Handelsnamen NutraSweet vermarktet 88. Als Searl 1985 von Monsanto übernommen wurde, führte Monsanto die Süßstoffproduktion als eigenständigen Unternehmensteil unter dem Namen NutraSweet Company weiter. Das Patent auf Aspartam lief jedoch 1992 aus, und Monsanto stieß die NutraSweet Company 2000 ab. Sie gehört heute dem privaten Investmentfonds J. W. Childs Equity Partners II, L. P.
Der weltweite Aspartam-Markt wird heute von mehreren Unternehmen beliefert. Als weitere Handelsnamen dazugekommen sind Canderel, Equal, Spoonfull, Equal Measure und Sanecta. Aspartam ist weltweit in mehr als 90 Ländern in ungefähr 9.000 Produkten enthalten V2 , 88.
In Deutschland wurde Aspartam im Juni 1990 gemäß Lebensmittelzusatzstoff-Zulassungsverordnung zugelassen 88, 91. In der Europäischen Gemeinschaft (die Vorläuferorganisation der Europäischen Union) wurde die Verwendung von Süßungsmitteln in Lebensmitteln im September 1994 geregelt 95. Die entsprechende Richtlinie erlaubt Aspartam für
- nichtalkoholische Getränke (max. 600 mg/L)
- Dessertspeisen und ähnliche Erzeugnisse (max. 500 bis 1.000 mg/kg)
- Süßwaren (max. 600 mg/L bis 5.500 mg/kg)
- Nahrungsergänzungen/Bestandteile einer Diät auf Vitamin- und/oder Mineralstoffbasis in Form von Sirup oder Kautabletten (max. 25 mg/L bis 6.000 mg/kg)
Die ganze Liste enthält Getränke auf Wasser-., Milch- oder Fruchtsaftbasis, Dessertspeisen auf der Basis von Wasser, Milch, Obst, Gemüse, Eiern, Getreide oder Fetten, Knabbererzeugnisse auf der Basis von Stärke oder Nüssen, Süßwaren auf der Basis von Kakao, Trockenfrüchten oder Stärke, Brotaufstriche auf Kakao-, Milch-, Trockenfrucht- oder Fettbasis, Kaugummi, Apfel- und Birnenwein, Biere verschiedener Art, Speiseeis, Obst- und Gemüsekonserven, Konfitüren, Gelees und Marmeladen, Konserven von Fischen und Marinaden von Fischen, Krustentieren und Weichtieren, Saucen, Senf, Backwaren, vollständige Mahlzeiten für Übergewichtige, Nahrungsergänzungsmittel und Diätergänzungsstoffe, Frühstücksgetreideerzeugnisse, Suppen, Süßwaren zur Erfrischung des Atems, Rachenerfrischungspastillen, Mischungen aus alkoholischen und nichtalkoholischen Getränken, Spirituosen mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15 % und Feinkostsalat.
Die Geschichte vom Aspartam hat seither auch eine europäische Version. Die Rolle der FDA hat dabei die EFSA übernommen (EFSA für „European Food Safety Authority“, Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit).
Die Europäische Ramazzini-Stiftung für Krebsforschung in Bologna bemüht sich schon seit langem um ein Verbot von Aspartam – und ist damit zuletzt im April 2009 gescheitert 91, 96, 97. Die EFSA ist der Meinung: „Das Süßungsmittel Aspartam und seine Abbauprodukte sind seit mehr als 30 Jahren Gegenstand umfassender Untersuchungen, darunter Tierversuchsstudien, klinische Studien, Verzehrstudien, epidemiologische Untersuchungen und Überwachungsstudien nach dem Inverkehrbringen. Aufgrund eingehender Sicherheitsbewertungen gilt Aspartam als unbedenklich für den menschlichen Verzehr und ist hierfür in zahlreichen Ländern seit vielen Jahren zugelassen.“ 98
Der Deutsche Süßstoffverband kommentierte das Geschehen auf seine Weise: „Diese Feststellung durch die EFSA entspricht gänzlich der weltweiten wissenschaftlichen Meinung.“ 97 Man glaubte gar zu wissen: „Die Anschuldigungen des Ramazzini-Institutes sind nur darauf ausgelegt, Verbraucher über einen sicheren und nützlichen Nahrungsbestandteil zu verunsichern.“
Ralf C. Walton, Professor für Psychiatrie am Northeastern Ohio Universities College of Medicine sieht das anders 97, 99, 100. Er überprüfte insgesamt 164 Aspartam-Studien. 74 waren von der Süßstoffindustrie finanziert worden; und jede einzelne davon attestierte die Sicherheit von Aspartam. 90 waren unabhängig finanziert; und 83 davon kamen zu dem Ergebnis, dass Aspartam gesundheitsschädlich ist …
Zurück zur Wissenschaft
John Olney spricht aus, was offensichtlich ist: „Hier geht es in Wirklichkeit nicht um Wissenschaft, sondern um Politik.“ V3. Deshalb nun zu den wissenschaftlichen Aspekten der Geschichte.
Aspartam besteht aus drei Komponenten:
- 50 % sind Phenylalanin,
- 40 % Asparaginsäure und
- 10 % Methanol 88.
Phenylalanin (Betonung auf der zweiten und auf der letzten Silbe) ist mittels Methanol mit Asparaginsäure verknüpft. Im menschlichen Körper zerfällt Aspartam wieder in seine Ausgangsstoffe 101.
Phenylalanin ist eine essentielle Aminosäure 102. Das heißt, sie muss dem Körper mit der Nahrung zugeführt werden. Der Körper braucht sie, um Eiweiße zusammenzusetzen. Phenylalanin ist in vielen Lebensmitteln enthalten, z. B. Kürbiskernen, Erbsen, Walnüssen, Vollkornweizen, ungeschältem Reis und Mais.
In der Leber wird Phenylalanin auch zu einer anderen essentiellen Aminosäure umgewandelt: Tyrosin. Reicht das vorhandene Phenylalanin nicht dafür aus, muss Tyrosin ebenfalls mit der Nahrung aufgenommen werden. Kann umgekehrt Phenylalanin nicht in Tyrosin umgewandelt werden, so häuft sich Phenylalanin im Körper an.
Letzteres trifft für Menschen zu, die an Phenylketonurie (PKU), einer tiefgreifenden Entwicklungsstörung, leiden 103. Ihnen fehlt das Enzym, das beim Gesunden den Umbau von Phenylalanin zu Tyrosin bewerkstelligt. Das Gehirn kann nicht ausreifen; Schwachsinn und verkümmertes Körperwachstum sind die Folge. (Namensgebend für die Erkrankung waren Reaktionsprodukte des überschüssigem Phenylalanins, sogenannte Phenylketone, die mit dem Urin ausgeschieden werden.) Phenylalaninhaltige Lebensmittel können für Betroffene gefährlich sein. Aspartamhaltige Lebensmittel müssen deshalb mit Warnhinweis versehen sein: „Enthält eine Phenylalaninquelle“ 95.
Es hat sich jedoch gezeigt, dass sich auch bei Menschen, bei denen definitiv keine PKU vorliegt, große Mengen an Phenylalanin im Gehirn anreichern können, wenn sie entsprechende Mengen an Light-Getränken konsumieren 101, 104. Berichtete Symptome sind Kopfschmerzen, Gedächtnisverlust, emotionale Störungen wie heftige Stimmungsschwankungen und Depressionen, Schizophrenie und Epilepsie.
Methanol ist der einfachste Vertreter aus der Stoffgruppe der Alkohole 105-114. Wenn man von „Alkohol“ spricht, meint man meistens das bei der Herstellung von alkoholischen Getränken, wie Bier oder Wein, aus Zucker entstehende Ethanol (auch „Ethylalkohol“). Es ist Ergebnis einer von Hefen ausgelösten Gärung, in kleinen Mengen berauschend, in größeren einschläfernd und in noch größeren giftig. Ethanol ist das älteste und „beliebteste“ Rauschmittel des Planeten. Methanol (auch „Methylalkohol“) ist weniger berauschend, aber hochgiftig.
Methanol kommt in der Natur nur in geringen Mengen in Pflanzen vor, sie geben es als Spurengas in die Atmosphäre ab. Methanol hieß früher auch „Holzgeist“ (analog zum „Obstgeist“ oder „Himbeergeist“), weil es durch Destillation aus Holz gewonnen wurde. Heute wird es aus Kohlenstoffmonoxid und Wasserstoff hergestellt. Es ist Ausgangsstoff für viele komplexere chemische Verbindungen, z. B. Farben und Kunststoffe. Methanol hat einen sehr niedrigen Siedepunkt (65 °C) und ist daher sehr flüchtig. Beim Umgang mit methanolhaltigen Lacken oder Lösungsmitteln ist deshalb besondere Vorsicht geboten (so dass der Verarbeiter keine größeren Mengen davon einatmet). Unsachgemäß gebrannter Schnaps kann aus demselben Grund giftig sein. Denn bei der Gärung entsteht neben Ethanol stets auch etwas Methanol. Bei der Destillation verdampft Methanol aber zuerst. Wenn man das erste Destillat – den „Vorlauf“ - nicht wegschüttet, entsteht möglicherweise also ein gefährliches Gebräu.
Pflanzliche Zellwände sind aus verschiedenen Substanzen, u. a. Pektin, aufgebaut. Letzteres enthält Methanol, an Säuren gebunden, das durch Enzyme freigesetzt werden kann. Pektin ist insbesondere in unreifen Äpfeln, Quitten, Kirschen und Zitrusfrüchten enthalten. Pektin wird außerdem in der Lebensmittelindustrie als Dickungsmittel eingesetzt, da es Wasser bindet. Als solches ist es bsw. in Marmeladen, Gelees und Milchprodukten zu finden. Die freigesetzten bzw. eingesetzten Mengen sind gewöhnlich jedoch gesundheitlich irrelevant.
Methanol wird anders abgebaut als Ethanol. Die Leber spaltet Methanol mithilfe entsprechender Enzyme in Formaldehyd und Ameisensäure. Beide Stoffe werden aber nur sehr langsam über die Nieren ausgeschieden. Sie können sich deshalb im Körper anhäufen. Im Falle einer Methanolvergiftung setzt die Ameisensäure eine Azidose („Übersäuerung“) des Körpers in Gang. Das Formaldehyd wirkt lokal giftig und schädigt Organe, vor allem Augen, zentrales Nervensystem, Leber, Nieren und Herz. Bereits weniger als 30 ml Methanol können tödlich sein. (Methanol hat eine Dichte von 0,791 g/ml. Somit beträgt die Masse von 30 ml Methanol 30 ml ∙ 0,791 g/ml = 24 g.) Die durchschnittliche tödliche Dosis liegt zwischen 100 und 250 ml (zwischen 79 und 198 g).
Es gibt keine gesetzlichen Höchstmengen für Methanol in Wein und weinhaltigen Getränken. In Spirituosen darf nicht mehr als 10 mg Methanol pro 100 ml Ethanol enthalten sein. Der Grund ist, dass alkoholabbauende Enzyme eine ungleich stärkere Neigung zu Ethanol als zu Methanol haben, das heißt, Methanol in Anwesenheit von Ethanol nicht abbauen. (Deshalb besteht eine gängige Therapie bei Methanol-Vergiftungen darin, lange genug - über Tage hinweg - eine Ethanol-Konzentration von etwa 1 Promille im Blut aufrechtzuerhalten, bis das Methanol über die Nieren ausgeschieden ist.)
Nach einer Untersuchung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamts Stuttgart beträgt der durchschnittliche Methanol-Gehalt in Fruchtsaft und Fruchtnektar 41 mg/L, in Wein 81 mg/L, in Spirituosen 2.171 mg/L.
Wie viel Aspartam bzw. Methanol in irgendwelchen Light-Produkten enthalten ist, ist gewöhnlich unbekannt. Die täglich akzeptable Dosis von Aspartam wurde vor grauen Zeiten von Searle vorgeschlagen – und gilt auch heute noch. Sie beträgt 40 mg/kg Körpergewicht. Aspartam besteht zu 10 % aus Methanol. Somit wäre die täglich akzeptable Dosis von Methanol 4 mg/kg Körpergewicht. Für einen Mann mit 85 kg wäre das eine täglich akzeptable Dosis von 85 kg ∙ 4 mg/kg = 340 mg.
Asparaginsäure ist eine weitere Aminosäure 115. Anders als Phenylalanin ist es aber keine essentielle Säure; das heißt, sie muss dem Körper nicht zugeführt werden, sondern der Körper kann sie selbst herstellen. Ebenfalls anders als Phenylalanin wird es auch als neuronaler Überträgerstoff („Neurotransmitter“) verwendet – und hier liegt der Hase im Pfeffer. Freie Asparaginsäure liegt im Körper gewöhnlich als Aspartat - das heißt, in aktivierter Form - vor.
Nervenzellen („Neuronen“) generieren und leiten Elektrizität. Die elektrischen Ladungen laufen entweder von der Peripherie zum Gehirn (bei Wahrnehmungen und Empfindungen) oder vom Gehirn zur Peripherie (im Falle von Bewegungen). Eine Nervenzelle kann winzig klein und kugelrund sein (z. B. im Gehirn), und sie kann Fortsätze von einem Meter Länge haben (z. B. in den Extremitäten). Verschiedene Formen finden Sie in Abbildung 6.
Abb. 6: Verschiedene Formen von Neuronen: Neuron 1 könnte aus der Netzhaut des Auges stammen. Im Zellkörper links unten entstehen elektrische Impulse. Sie werden über einen kurzen Fortsatz weitergeleitet und über mehrere Endigungen abgegeben. Neuron 2 könnte diese Impulse aufnehmen und nach zentral weiterleiten. Neuron 3 nimmt Impulse über die kurzen Äste unten links auf und leitet sie über den Fortsatz rechts oben weiter: Beispiel einer Zelle des zentralen Nervensystems. (Rot jeweils der Zellkern.)
Die Impulse laufen in der Zellmembran und werden über Synapsen (von grch. „synapsis“, Verbindung) von einer Zelle zur nächsten weitergeleitet. (Das obige Axon 3 würde unten links Synapsen mit vorgeschalteten Axonen, oben rechts mit nachfolgenden Axonen bilden.) Die Neuronen sind gewöhnlich aber nicht miteinander verwachsen, sondern immer noch durch einen winzigen Spalt voneinander getrennt. Überträgerstoffe („Neurotransmitter“: engl. „transmitter“, Überträger; Überträgerstoff) haben die Aufgabe, die Impulse über den synaptischen Spalt zu transportieren. Es gibt Neurotransmitter, die dabei die Impulse hemmen (beruhigend wirken); und es gibt Neurotransmitter, die dabei die Impulse verstärken (erregend wirken).
„Aspartat und Glutamat sind die wichtigsten erregenden Neurotransmitter im ZNS“ (Birbaumer & Schmidt 1991). (Zu „Glutamat“ weiter unten mehr. Das „ZNS“ ist das „zentrale Nervensystem“: Gehirn und Rückenmark.)
Das Großhirn (auch „Endhirn“) ist der entwicklungsgeschichtlich jüngste Teil des Gehirns. Es besteht aus zwei halbkugelförmigen Hälften, die durch Kommissuren (vom lat. „commissura“, Verbindung: Querbahn) miteinander verbunden sind (siehe Abbildung 7). Die Kommissuren verlaufen am Grunde der großen Hirnlängsspalte (siehe die rechte Ansicht). Sie haben zum Teil doppelläufige Fasern, die hauptsächlich identische Areale der beiden Hirnhälften miteinander verbinden, z. B. Sehen, Hören oder Riechen, aber auch unterschiedliche Zentren, z. B. das Sehzentrum der einen und das Sprachzentrum der anderen Seite. Die Kommissuren des Großhirns arbeiten mit Aspartat.
Abb. 7: Menschliches Gehirn. Links Ansicht von links, rechts von hinten. Rot, in der Tiefe, die Kommissuren. Links zu sehen die größte Kommissur, der „Balken“, der vorn und hinten von kleineren Querbahnen ergänzt wird.
Das erklärt die Ergebnisse der allerersten Tests, die mit Aspartam gemacht wurden 91, 116. Harold Waisman, ein Biochemiker der Universität Wisconsin führte sie im Auftrag von Searle durch. Er verabreichte sieben junge Affen aspartamhaltige Milch. Einer starb, fünf hatten heftige epileptische Anfälle. Es erklärt, weshalb Olney die besagten Hirnschäden bei den Mäusen fand, die er mit Aspartam gefüttert hatte. Und es erklärt, weshalb die meisten Nebenwirkungen von Aspartam neurologischer Art sind 111.
Ralf C. Waltons erste Veröffentlichung zum Thema Aspartam aus dem Jahre 1986 war ein Fallbericht 100. Er betraf eine Patientin, deren epileptische Anfälle und manische Episoden er auf den Konsum großer Mengen von Aspartam zurückführte. Walton beschäftigte sich danach 20 Jahre lang mit Epilepsiekranken. Sein anfänglicher Verdacht, dass Aspartam epileptische Anfälle auslösen könnte, wurde dabei zur Gewissheit. Walton führte 1993 eine Studie durch, über die er schreibt: „Ich hatte nicht mit derart drastischen Reaktionen gerechnet, die die Ethikkommission veranlassten, die Studie vorzeitig zu abzubrechen. Trotz der daraus resultierenden geringen Probandenzahl waren die Befunde jedoch statistisch signifikant und zeigten, dass insbesondere Leute mit emotionalen Störungen anfällig für eine ganze Reihe von krankhaften Reaktionen waren“ 100.
John Symes „Epilepsie-Diät“ aus dem Jahre 2005 ist eine „Glutamat/Aspartat-reduzierte Diät“. Es ist die Diät, „die so vielen Tieren und Menschen mit Epilepsie, ADS, Insomnie, Fibromyalgie, chronischer Erschöpfung/Depressionen, Zöliakie, Sodbrennen und vielem anderen mehr geholfen hat“ (Symes ist von Beruf Tierarzt) 117.
ADS: Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom.
Insomnie (vom lat. „in-“, nicht, un- + „somnus“, Schlaf): Schlafstörung mit Schlafdefiziten.
Fibromyalgie (vom lat. „fibra“, Faser + grch. „mys“, Muskel + grch. „algos“, Schmerz): Schmerzstörung mit schmerzenden Muskeln, Bindegeweben und Knochen.
Zöliakie (vom grch. „koiliakos“, „an der Verdauung leidend“; zu „koilia“, Bauchhöhle): chronische Verdauungsstörungen.
Aspartam-Freunde haben oft einzuwenden, dass die Blut-Hirn-Schranke kein Aspartat ins Gehirn lassen würde. Es ist zumindest keine „politische“, sondern eine „wissenschaftliche“ Idee – um Olneys Wortwahl zu verwenden.
Die Blut-Hirn-Schranke ist eine Barriere zwischen Blutkreislauf und Gehirn 118. Sie besteht im wesentlichen aus Deckzellen, die eng genug miteinander verbunden sind, um keine Spalträume freilassen. Sie kleiden die Haargefäße aus - die überall im Körper den Übergang vom arteriellen zum venösen System bilden und den Stoffaustausch zwischen Blut und Zwischenzellraum ermöglichen. Die Zellen des Blut-Hirn-Schranke bilden einen hochselektiven Filter, dessen Transportsysteme dem Gehirn notwendige Nährstoffe zuführen und Stoffwechselrückstände abführen. Sinn und Zweck der Einrichtung ist es, das Gehirn vor zirkulierenden Krankheitserregern, Giften, Hormonen u. ä. zu schützen.
Idealerweise schützt die Blut-Hirn-Schranke das Gehirn vor einem erhöhten Aspartat- oder Glutamat-Blutspiegel 112, 113, 117. Doch der Idealzustand ist nicht immer gegeben. Erstens ist die Blut-Hirn-Schranke im Kindesalter noch nicht oder nicht vollständig entwickelt. Zweitens schützt die Blut-Hirn-Schranke, auch wenn sie vollständig entwickelt ist, niemals das ganze Gehirn. Drittens wird die Blut-Hirn-Schranke durch bestimmte Einflüsse in Mitleidenschaft gezogen: dazu gehören gehärtete Fette, verschmutzte Atemluft und Elektrosmog ebenso wie Immunreaktionen des Körpers. Und viertens ist die Blut-Hirn-Schranke nicht darauf ausgerichtet, mit freiem Aspartat und/oder Glutamat überschwemmt zu werden.
Aspartat und Glutamat sind die wichtigsten erregenden Überträgerstoffe, zugleich aber auch die stärksten der rund 70 heute bekannten Erregungs-Toxine (grch.„toxikos“, Gift) – ein Begriff, der im übrigen auf Olney zurückgeht 119. Erhöhte Mengen an freiem Aspartat oder Glutamat führen zu einer Entgleisung der neuronalen Aktivität. Das Membranpotential (das Spannungsgefälle zwischen Innenseite und Außenseite der Zellmembran) steigt an. Nervenzellen werden geschädigt und sterben ab. Der Überträgerstoff wird zum Erregungs-Toxin.
Neuere Entwicklungen
Acesulfam ist ein weiterer Süßstoff – und ein weiteres Zufallsprodukt 120. Ort des Geschehens war diesmal die Hoechst AG. Genau genommen ist es das Kalium-Salz von Acesulfam; deshalb heißt es auch Acesulfam-K. Es ist seit 1990 in Deutschland zugelassen und wird unter dem Markennamen Sunett vertrieben. Aspartam wird mit Acesulfam zu Aspartam-Acesulfam-Salz kombiniert 121, 122.
Von Acesulfam sind bislang keine schädlichen Nebenwirkungen bekannt. Es wird im Körper nicht abgebaut und unverändert über die Nieren ausgeschieden. So gelangen allerdings große Mengen ins Abwasser, was zunehmend zu einem Umweltproblem wird. Es lässt sich auch mit den besten Kläranlagen nicht aus dem Abwasser entfernen. Deshalb findet man es in Flüssen, Seen und – wenn auch nur in geringen Mengen – im Trinkwasser. Auswirkungen auf die Umwelt sind bisher nicht erforscht.
Cyclamat ist 30- bis 40-mal, Acesulfam 130- bis 200-mal, Aspartam 200-mal, Aspartam-Acesulfam-Salz 350-mal und Saccharin 300- bis 500-mal süßer als Zucker 123. Doch Monsanto schuf 2001 einen Nachfolger für Aspartam: Neotam 124.
Die Süßkraft von Neotam ist 7.000- bis 13.000-mal stärker als die von Zucker und 30- bis 60-mal stärker als die von Aspartam 124 125. Neotam ist eine Verbindung von Aspartam und 3,3-Dimethylbutyraldehyd. Letzteres ist eine als gefährlich eingestufte Substanz 126. Sie reizt Augen, Atmungsorgane und die Haut. Rauch oder Dämpfe sollten nicht eingeatmet werden. Aber natürlich sind nur geringste Mengen notwendig, um irgendetwas damit zu süßen.
Es scheint kein Problem für Monsanto gewesen zu sein, die FDA zu einer Zulassung zu bewegen 125, 127. Der Clou – nach all den Querelen um Aspartam – ist aber, dass Neotam in den USA auf keiner Zutatenliste erscheinen muss. Neotam ist in den USA nicht kennzeichnungspflichtig. Es scheint unglaublich, aber möglicherweise haben die Leute von Monsanto irgendeine Regelung für sich in Anspruch genommen, die für (gewöhnliche) Zutaten unter einem bestimmten prozentualen Anteil am Produkt gilt.
Neotam ist seit Januar 2010 auch in der EU zugelassen 125, 127. Es unterliegt hier allerdings der Kennzeichnungspflicht – bislang jedenfalls. Doch Neotam wird in den USA - unter dem Namen Sweetos - auch als Tierfutterzusatz vertrieben. Craig Petray von NutraSweet meinte: „Ein wirtschaftlicher Ersatz für die Melasse ist Sweetos. Sweetos überdeckt unangenehmen Geschmack und Gestank und verbessert die Schmackhaftigkeit des Futters. Dieses Produkt wird für Bauern und Hersteller von Viehfutter wirtschaftlich sein. Es kann auch in Mineralmischungen verwendet werden.“ Und Mohan Nair von Ensigns Health Care, einem Hauptproduzenten von Sweetos, setzt hinzu: „Dieses Produkt hat ein hohes Exportpotenzial.“ Hier kommt also einiges auf uns zu.
Erst einmal jedoch scheint Monsanto seinen Meister im japanischen Ajinomoto-Konzern gefunden zu haben 128. Ajinomotos erfolgreichstes Produkt ist Mononatriumglutamat – die Mutter aller Geschmacksverstärker. Es ist so erfolgreich, dass der Name Ajinomoto, der soviel heißt wie „die Essenz des Geschmacks“, in Japan als Gattungsname für Geschmacksverstärker verwendet wird, ganz gleich wer sie herstellt. Ajinomoto ist der weltweit größte Hersteller sowohl von Mononatriumglutamat wie auch von Aspartam. Die Japaner dachten sich, sie könnten Aspartam verbessern und fügten ihm den künstlichen Aromastoff Vanillin hinzu 129. Die neue Version heißt Advantam.
Advantam hat die 20.000- bis 37.000-fache Süßkraft von Zucker 123, 129. Bereits winzige Mengen genügen, um Lebensmitteln einen süßen Geschmack zu geben. Es ist billiger denn je, Lebensmittel zu süßen. Die FDA genehmigte die Verwendung von Advantam in einer Vielzahl von Produkten im Mai, die EFSA im Juni 2014 130-132.
Industriekost
Fleisch galt zu allen Zeiten als besonders kräftigende Nahrung. Vielleicht war der Anblick von Beute schlagenden Raubtieren allzu beeindruckend für den Homo sapiens. Sein erstes (Halb)Fertiggericht jedenfalls war Fleischextrakt 133, 134.
Schon im 17. Jahrhundert kam man in England auf die Idee, gemahlenes Fleisch in Wasser zu kochen und den Sud zu einer mehr oder weniger trockenen Masse zu reduzieren. „Tragbare Suppe“ nannte man es. Kleine Stückchen davon, mit heißem Wasser aufgegossen, ergaben eine Art Fleischbrühe. Ähnlich stellte man später in Frankreich „Bouillontafeln“ her. Sie dienten als Proviant für Schiffsbesatzungen.
Allgemein bekannt wurde die Idee mit Justus von Liebig. Es war 1854, als die Tochter eines Bekannten an Typhus erkrankt war und keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen konnte. Liebig versuchte es mit einem Fleischtrank als Krankenkost. Das Mädchen erholte sich (tatsächlich), und Liebig veröffentlichte sein Rezept in den „Annalen der Chemie“ (Annalen sind Jahrbücher; vom lat. „annus“, Jahr) unter dem Titel „Eine neue Fleischbrühe für Kranke“.
Der Unternehmer Georg Christian Gilbert las den Artikel und bot Liebig eine industrielle Vermarktung seines Produkts an. In Südamerika gab es zu jener Zeit einen beträchtlichen Überschuss an Rindfleisch. Rinder wurden vor allem wegen der Häute, Hörner und Knochen gehalten. Das Fleisch konnte aufgrund fehlender Kühlmöglichkeiten nicht über weite Strecken transportiert werden. So wurde die LEMCO („Liebig’s Extract of Meat Company“, Liebigs Fleischextrakt-Gesellschaft) gegründet - eines der ersten Unternehmen der Lebensmittelindustrie. Sie brachte Liebigs Fleischextrakt in den 1880-er Jahren auf den europäischen Markt. Liebig hatte es eigentlich als kräftigende Nahrung für die ärmere Bevölkerung gedacht. Allerdings erwies es sich dafür als zu teuer. So wurde es als Teil der Truppenverpflegung, z. B. der britischen und deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, verwendet.
Die von LEMCO vertriebenen Brühwürfel bestanden noch aus Fleischextrakt, Rindertalg und pflanzlichen Würzstoffen 134, 135. 1909 bot Maggi erstmals Brühwürfel an, die statt Fleischextrakt Würze aus denaturiertem Pflanzeneiweiß enthielt. Als Ausgangsprodukt dienten Sojabohnen und Weizen. Sie wurden in Salzsäure gekocht, und anschließend mit Natronlauge neutralisiert (in ihrem Säuregehalt reduziert), wobei sich auch reichlich Kochsalz bildete. Die so erhaltene Würze hatte einen an Fleisch erinnernden Geschmack, war jedoch viel billiger als Fleischextrakt herzustellen – weshalb sich der Maggi-Würfel und ähnliche Produkte von Knorr und anderen Liebigs Fleischextrakt gegenüber durchsetzen konnten und heute fast ausschließlich angeboten werden.
Die Brühwürfel von heute sind quaderförmig gepresste Mischungen aus Salz, getrockneter Würze, Geschmacksverstärkern und Süßungsmitteln, die mit Fett – meist gehärtetem Pflanzenöl – gebunden sind 134. Ja nach Marke und Sorte können weitere Stoffe, wie Karamell, Sellerieextrakt, Gemüse und (tatsächlich auch) Fleischextrakt enthalten sein.
Brühwürfel und fette Brühe unterschieden sich im wesentlichen nur in ihrem Gehalt an Pflanzenöl. In Gemüsebrühwürfeln sind auch geringe Mengen an Gemüse zu finden. In Fleischbrühwürfeln und Fischbrühwürfeln müssen per EU-Verordnung mindesten 670 mg Fleisch- bzw. Fischextrakt pro Liter Brühe enthalten sein.
Biobrühwürfel dürfen gemäß EU-Verordnung eigentlich keine Geschmacksverstärker enthalten, was aber – aus welchen Gründen auch immer - nur für deren isolierte Form gilt. So kommt es, dass in Biobrühwürfeln durch Zugabe von Hefeextrakt gewöhnlich Mengen an freiem Mononatriumglutamat enthalten sind, die denen konventionell hergestellter Brühwürfel vergleichbar sind.
Brühwürfel und Trockensuppen („Tütensuppen“ oder in Bayern und Österreich „Packerlsuppen“) werden heute als Teilfertiggerichte bezeichnet 136-138. Sie bedürfen noch der Zugabe von Komponenten, z. B. Wasser oder Milch. Unter Fertiggerichten versteht man Mahlzeiten, die komplett vorbereitet sind und nur noch erwärmt werden müssen 136, 139, 140. Dazu gehören Konserven aller Art, Tiefkühlkost und vakuumverpackte Gerichte.
Derlei Industriekost wird gewöhnlich mit einer ganzen Reihe von Zusatzstoffen versehen, um ihnen Geschmack zu geben und sie ansehnlich und nicht zuletzt haltbar zu machen: Backtriebmittel, Farbstoffe, Festigungsmittel, Geliermittel, Geschmacksverstärker, Konservierungsmittel, Säuerungsmittel, Schaummittel, Schaumverhüter, Stabilisatoren, Süßungsmittel, Verdickungsmittel, Feuchthaltemittel und einiges mehr 141, 142. Über 300 Lebensmittelzusatzstoffe sind heute in der EU zugelassen 143.
„In der Europäischen Union (EU) sind alle Lebensmittelzusatzstoffe mit E-Nummern gekennzeichnet, und sie sind immer auf den Verpackungen der Lebensmittel, in denen sie verwendet werden, auf der Liste der Inhaltsstoffe anzugeben. Auf dem Etikett muss sowohl die Funktion des Zusatzstoffs im fertigen Lebensmittel (z. B. „Farbstoff“, „Konservierungsstoff“ etc.) als auch die spezifische verwendete Substanz mit entsprechender E-Nummer oder dem Namen (z. B. „E 415“ oder „Xanthangummi“) aufgeführt sein“ 144.
Zusatzstoffe dürfen jedoch nur mit ausdrücklicher Genehmigung verwendet werden 142, 145. Zulassungen werden nur erteilt, wenn keine gesundheitlichen Bedenken bestehen, wenn die Stoffe „technologisch notwendig“ sind und wenn sie den Verbraucher nicht täuschen. Als Maß für Unbedenklichkeit wird gewöhnlich der ADI-Wert verwendet (ADI steht für engl. „acceptable daily intake“, akzeptable tägliche Zufuhr) 146. Es gibt per Definition die Menge des Stoffs an, die täglich über die gesamte Lebenszeit hinweg verzehrt werden kann, ohne dass dadurch gesundheitliche Schäden zu erwarten sind. Maßeinheit ist Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag oder kurz Milligramm pro Körpergewicht (mg/kg Körpergewicht).
Grundlage des ADI-Werts sind Fütterungsversuche bei Tieren, z. B. Mäusen oder Ratten 147. Der Zusatzstoff wird in unterschiedlichen Dosen verabreicht; und man stellt fest, welche Menge maximal verfüttert werden kann, ohne dass gesundheitsrelevante Effekte zu beobachten wären. Das ist der NOEL-Wert (NOEL steht für engl. „no-observed-effect-level“, Menge ohne beobachtbaren Effekt). Der NOEL-Wert wird mit dem Sicherheitsquotienten 10 auf den Menschen übertragen, und schon hat man den ADI-Wert. Ein NOEL-Wert von 100 mg/kg Mausegewicht ergibt also einen ADI-Wert von 10 mg/kg Körpergewicht.
Für einige Stoffe jedoch sind vonseiten der Zulassungsbehörde keine ADI-Werte angegeben worden, was verschiedene Gründe haben kann 146. Es könnte sein, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass bei ordnungsgemäßer Verwendung des Stoffs und bei gewöhnlichen Essgewohnheiten irgendwelche gesundheitlichen Gefahren zu erwarten wären. Es könnte aber auch sein, dass kein NOEL-Wert für einen Stoff zu ermitteln war. Im Tierversuch waren bei jeder Dosis gesundheitsrelevante Effekte zu beobachten. Die Zulassungsbehörde (EFSA) kann dennoch zu dem Schluss kommen, dass bei der in Frage stehenden Verwendung und bei den gewöhnlich verzehrten Mengen keine gesundheitlichen Gefahren zu erwarten sind - und den Stoff zulassen.
Die Probleme des Verfahrens sind offensichtlich – selbst wenn man davon absieht, dass physiologische Vorgänge in tierischen und menschlichen Körpern gleichgesetzt werden: Wie möchte man vorherzusagen können, dass eine bestimmte Menge eines Stoffs, täglich und ein ganzes Leben lang konsumiert, nicht irgendwann irgendwelche „gesundheitsrelevante Effekte“ haben könnte? Wie möchte man vorhersagen können, dass ein Mann, der sich im Laufe von 50 Jahren insgesamt rund einen halben Zentner Aspartam-Acesulfam-Salz einverleibt, keine gesundheitlichen Probleme dadurch bekommt? (ADI = 20 mg/kg Körpergewicht; das sind bei einem durchschnittlichen Gewicht von 80 kg in 50 Jahren: 20 mg ∙ 80 ∙ 365 ∙ 50 = 29 kg) Wie möchte man vorhersagen können, dass ein Mann, der täglich irgendwelche Mengen an Mononatriumglutamat zu sich nimmt, nicht irgendwann davon krank wird? (Für Mononatriumglutamat wurde bisher nicht einmal ein ADI-Wert festgelegt. Lediglich eine maximale Verzehrmenge von 10 g/kg Lebensmittel ist seit 2011 in der EU vorgeschrieben.)
Doch das sind nur die einzelnen Probleme, für sich betrachtet. Das wirkliche Problem beginnt mit der Vielzahl der Stoffe und den möglichen Wechselwirkungen zwischen ihnen. Wer wollte ernsthaft behaupten, dass ein Mensch, der täglich eine Auswahl aus rund 300 Lebensmittelzusatzstoffen in und mit seiner Nahrung zu sich nimmt, kein gesundheitliches Risiko einginge, wenn etwa 250 davon im Verdacht stehen, Allergien und Krankheiten auszulösen 148?
Darüber hinaus ist es oft unergründlich, was eigentlich in der Tiefkühlpizza, der Tütensuppe oder den Kartoffel-Chips enthalten ist 149, 150. Per Gesetz muss nur deklariert werden, was eine (unmittelbare) Funktion im Lebensmittel hat. Der Emulgator Carrageen beispielsweise, der dafür sorgt, dass sich Fett in Wasser mischt, muss auf dem Sahnebecher angegeben werden. Wenn aber die Sahne in Rahmspinat verarbeitet wird, ist das Carrageen nicht mehr auf der Verpackung zu finden, weil es seine Funktion verloren hat und „keine technologische Wirkung“ mehr im Endprodukt ausübt. Aus demselben Grund werden die Rieselhilfen im Salz auf der Chips-Tüte und die Konservierungsstoffe im Obst auf der Tortenschachtel nicht erwähnt. Die Spuren werden verwischt.
Ähnliches gilt für Aromen, die wie Zusatzstoffe auf der Zutatenliste abgepackter Lebensmittel anzugeben sind. Das Aroma (grch. „aroma“, Gewürz; Duft) ist ein spezifischer Duft und/oder Geschmack, der durch einzelne Aromastoffe oder ein Gemisch solcher Stoffe z. B. in Pflanzen und Lebensmitteln erzeugt wird 151. In der Natur wurden bisher etwa 10.000 Aromastoffe identifiziert. Die Aromenindustrie verwendet etwa 2.500 davon. Andere Aromastoffe werden künstlich hergestellt.
Die Aromenverordnung der EU aus dem Jahre 2008 unterscheidet sechst Kategorien von Aromen/Aromastoffen:
- Aromastoffe haben zwei Unterkategorien:
Natürliche Aromastoffe werden durch physikalische, enzymatische oder mikrobiologische Verfahren gewonnen 151-153. Ein schonendes physikalisches Verfahren ist die Pressung. Es wird vor allem verwendet, um ätherische Öle z. B. aus Anis, Fenchel, Zitronengras oder Bittermandeln zu gewinnen. Ein anderes Verfahren ist die Destillation, bei der man die Aromastoffe im heißen Wasserdampf löst. Es ist aber nur für robusteres Pflanzenmaterial wie Hölzer, Kräuter oder Wurzeln geeignet. Bei enzymatischen Verfahren löst man mithilfe eines Enzyms eine Reaktion aus, an deren Ende ein Aromastoff steht. So lässt sich bsw. Anisaroma oder Ananasaroma für Weihnachtsgebäck, Süßwaren und Liköre herstellen. Bei mikrobiologischen Verfahren wird der Aromastoff mithilfe eines Mikroorganismus gewonnen. Heutzutage werden bereits genetisch veränderte Bakterien verwendet, um bsw. Kokus- und Pfirsicharomen herzustellen.
Künstliche Aromastoffe werden synthetisch im chemischen Labor hergestellt. Sie haben entweder ein Vorbild in der Natur, dem sie (als isolierter Stoff) nachgebaut sind, z. B synthetisch hergestelltes Vanillin (in der Natur in den Kapselfrüchten der Gewürzvanille) oder Menthol (in der Natur in der Minze zu finden), oder auch nicht.
- Aromaextrakte sind komplexe Gemische natürlicher Aromastoffe. Es gibt Extrakte aus Früchten, Gemüse, Kräutern, Gewürzen, Fleisch und Fisch. Sie werden genauso gewonnen wie „natürliche Aromastoffe“.
- Thermisch gewonnene Reaktionsaromen (grch. „therme“, Wärme) entstehen durch Erhitzen von zucker- und eiweißhaltigem Material. Es handelt sich um die in der Nummer 4 dieser Artikelreihe behandelten Maillard-Reaktionen: „Zaubereien“ aus dem Labor 154.
- Raucharomen erhält man, indem man Rauch in Wasser auffängt. Die mit Raucharomen versehenen Lebensmittel werden entweder damit getränkt oder besprüht.
- Aromavorstufen sind Stoffe, als solche ohne Geruch und Geschmack 155. Beim Erhitzen entstehen jedoch thermisch gewonnene Reaktionsaromen. Die Maillard-Reaktion findet also erst statt, wenn man das Lebensmittel erhitzt.
- Sonstige Aromen könnten bsw. durch Erhitzen von Pflanzenölen entstehen.
In der Europäischen Gemeinschaft wurde im Juli 2000 ein Programm zur Bewertung von Aromen/Aromastoffen auf den Weg gebracht 156-160. Es wandte sich zunächst an die erste der obigen Kategorien: „Aromastoffe werden Lebensmitteln zugesetzt, um ihnen einen besonderen Geschmack und/oder Geruch zu verleihen. Sie werden in einer Vielzahl von Lebensmitteln verwendet, von Süßwaren und Limonaden über Frühstücksflocken und Joghurts. Aromastoffe kommen in vergleichsweise niedrigen Mengen zum Einsatz, so dass der Verbraucher ihnen nur in relativ geringen Mengen ausgesetzt ist“ 157.
Geprüft wurden sowohl Stoffe, die bereits auf dem Markt waren, wie auch neue Stoffe. Die Mehrheit der Stoffe gab keinen Anlass zu Sicherheitsbedenken. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (ESFA) veröffentlichte im Oktober 2012 eine sogenannte Positivliste: eine Liste aller in der EU erlaubten Aromastoffe (als Anhang der Aromenverordnung aus dem Jahre 2008). Sie wird ab April 2013 verwendet und umfasst bisher etwa 2.500 Stoffe. Für die weiteren obigen Kategorien sind Ergebnisse für den Oktober 2016 angekündigt.
Was heißt das? Auf der Zutatenliste aromatisierter Lebensmittel müssen Aromen mit dem Wort „Aroma“ oder einer genaueren Bezeichnung gekennzeichnet werden 161. Hier solche Bezeichnungen und was sie bedeuten am Beispiel für Erdbeeren: 162, 163
|
Was auf der Packung steht |
Was damit gemeint ist |
|
Erdbeeren |
Erdbeeren oder Erdbeerstückchen |
|
Natürliches Erdbeeraroma |
Natürliches Erdbeeraroma, aus Erdbeeren hergestellt, z. B. destilliert. |
|
Natürliches Aroma |
Das Aroma ist natürlicher Herkunft, muss aber nicht von Erdbeeren stammen. Es kann auch mithilfe von Bakterien, Pilzen oder Hefen aus natürlichen Grundstoffen, z. B. Holzspänen, hergestellt werden. |
|
Aroma Erdbeeraroma mit Erdbeergeschmack |
Chemisch definierter Stoff mit Aromaeigenschaften. Natürliches Erdbeeraroma besteht aus mehreren hundert Substanzen. Einige davon können nachgebaut sein (früher „naturidentisches Aroma“). Es kann auch keine Ähnlichkeit mit natürlichen Aromastoffen bestehen. |
So kommt es, dass heute kaum noch jemand weiß, was er eigentlich isst, und der Hersteller der Industriekost oft selbst nicht weiß, was genau er den Leuten verkauft 149.
Geschmacksverstärker
Glutamate sind (zunächst) Salze der Glutaminsäure 164, 165. Salze bestehen aus Säuren und Basen. Natriumglutamat ist das Natrium-Salz der Glutaminsäure. (Die chemische Bezeichnung ist „Mononatriumglutamat“.) Natrium ist in diesem Fall die Base.
Natriumglutamat wurde 1866 von dem deutschen Professor für „Agrikulturchemie“ Heinrich Ritthausen in Pflanzen gefunden 166. Der japanische Chemiker Kikunae Ikeda - der interessanterweise zwei Jahre an der Universität Leipzig studierte, an eben der Universität, an der Ritthausen einige Jahrzehnte vorher promoviert hatte –, entdeckte 1908 die Bedeutung von Natriumglutamat für die Geschmacksqualität 167. Er fand den Stoff in einem Algenextrakt (Kombu), das von jeher in der japanischen Küche verwendet wird, und erkannte darin die geschmacksverstärkende Wirkung der Alge.
Ikeda nahm sogar eine fünfte Geschmacksqualität – neben süß, sauer, salzig und bitter – dafür an 168. „Umami“ nannte er sie, was soviel heißt wie „wohlschmeckend“. Knapp 100 Jahre später, im Jahre 2000, fanden Wissenschaftler der Universität Miami tatsächlich die dazugehörigen Geschmacksrezeptoren auf der Zunge 169-171. Sie reagieren allerdings nur, wenn gleichzeitig auch mindestens eine der vier anderen Kategorien aktiv ist. Natriumglutamat vermittelt also keine neue Geschmacksqualität, sondern das, wofür es schon die ganze Zeit steht: Geschmacksverstärkung. Ob der Umami-Geschmack eine Erkenntnis oder eine Werbeidee war, sei dahin gestellt; als letztere hat sie jedenfalls phantastisch gut funktioniert.
Da Ikeda nicht nur Chemiker, sondern auch Geschäftsmann war, entwickelte er die Idee, Natriumglutamat aus Algen oder anderen Pflanzen zu extrahieren und als Geschmacksverstärker zu verwenden. Zusammen mit dem Industriellen Saburosuke Suzuki gründete er 1909 ein Unternehmen, um seine Idee zu vermarkten. Das wundersame Pulver - es sieht aus wie raffinierter Zucker – wurde zu einem durchschlagenden Erfolg. Das Unternehmen heißt seit 1946 Ajinomoto (siehe oben) 128.
Ein mehr oder weniger natürlicher Stoff
Natriumglutamat in isolierter Form ist, was wir als Geschmacksverstärker kennen. Grundsätzlich aber ist Natriumglutamat ein natürlicher Stoff, der in andere Stoffe eingebunden, weit verbreitet ist.
Die geschmacksverstärkende Wirkung von Natriumglutamat stammt von der Glutaminsäure 168. Es ist eine der 20 Eiweiß bildenden Aminosäuren. Deshalb kommt sie in allen pflanzlichen und tierischen Organismen vor; und deshalb ist sie auch in fast allen eiweißhaltigen Lebensmitteln enthalten 172. Die in der Tabelle unten angegebenen Mengen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, auf die üblicherweise zum Genuss bestimmte Zubereitungsform (z. B. gekocht, gebraten oder roh).
Nicht alle Lebensmittel sind aber natürlicher Art. Deshalb finden wir auf den Spitzenplätzen die Hauptallergene des Menschen; wir finden Fleisch, das nicht sonderlich für den Menschen geeignet ist; und wir finden Soja (der „Fehler des Ostens“). Zu Nüssen und Mandeln ist anzumerken, dass sie gewöhnlich nur in geringen Mengen verzehrt werden – oder verzehrt werden sollten.
Extreme Mengen an Glutaminsäure enthalten Eiweißextrakte aus Weizen, Milch und Soja. Beim Gluten (Klebereiweiß des Weizens) sind es 30 % (30 g/100 g), beim Milcheiweiß 16,5 %, (16,5 g/100 g), beim Sojaeiweiß 13 % und beim Magermilchpulver 7,2 %.
|
Lebensmittel |
Gehalt an Glutaminsäure |
|
Hart- und Schnittkäse |
5.000 bis 8.000 mg/100 g |
|
Sojabohnen, roh |
6.800 mg/100 g |
|
Erdnüsse |
5.000 mg/100 g |
|
Mandeln |
4.500 mg/100 g |
|
Fleisch |
3.900 bis 4.500 mg/100 g |
|
Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste), nicht erhitzt |
2.400 bis 3.500 mg/100 g |
|
Fisch |
2.800 bis 3.000 mg/100 g |
|
Sonstige Nüsse |
2.500 bis 2.900 mg/100 g |
|
Sojabohnen, gekocht |
2.800 mg/100 g |
|
Magerquark |
2.800 mg/100g |
|
Tofu |
1.500 bis 2.600 mg/100 g |
|
Hühnerei |
1.500 mg/100 g |
|
Glutenhaltige Getreide (Weizen, Roggen, Gerste), erhitzt |
600 bis 1.500 mg/100 g |
|
Hülsenfrüchte |
600 bis 1.500 mg/100 g |
|
Frischmilchprodukte |
600 bis 700 mg/100 g |
|
Glutenfreie Getreide (Reis, Mais, Hirse) |
300 bis 500 mg/100 g |
|
Gemüse |
100 bis 400 mg/100 g |
|
Früchte |
30 bis 200 mg/100 g |
|
Bier |
60 bis 100 mg/100 g |
|
Kokosmilch |
50 mg/100 g |
|
Wein |
10 bis 30 mg/100 g |
|
Getreidestärke |
10 bis 20 mg/100 g |
|
Alkoholfreie Getränke |
0 bis 50 mg/100 g |
Die Geschichte vom Glutamat
Natriumglutamat ist einer der ältesten Lebensmittelzusatzstoffe überhaupt. Es wurde schon verwendet, als sich noch kaum jemand Gedanken über die Ernährung machte. Vielleicht schlug die Geschichte vom Natriumglutamat und anderen Glutamaten deshalb nie so hohe Wellen wie die vom Aspartam, doch beide sind sich in der Tat sehr ähnlich.
In den USA wurde 1958 ein Gesetz erlassen, nach dem Lebensmittelzusatzstoffe vom Hersteller getestet werden müssen, wobei er deren Unbedenklichkeit nachzuweisen hat, bevor er eine Zulassung dafür erhalten kann. Für Zusatzstoffe, die bereits auf dem Markt waren, veröffentlichte die FDA 1959 eine Art Unbedenklichkeitsliste: eine Liste von Zusatzstoffen, die „allgemein als sicher anerkannt“ galten und deshalb von der neuen Regelung ausgenommen waren 173. Die Liste umfasste 700 Zusatzstoffe, darunter auch Natriumglutamat. Die Probleme damit begannen erst später.
Robert Ho Man Kwok, ein gebürtiger Chinese und als Mediziner an der National Biomedical Research Foundation in Silver Spring, USA tätig, berichtete 1968 als erster über eigentümliche Beschwerden beim Besuch chinesischer Restaurants 174-176. „Das Syndrom, das gewöhnlich 15 bis 20 Minuten nach dem ersten Gang beginnt“, schrieb er im New England Journal of Medicine, einem amerikanischen Ärzteblatt, „hält ungefähr zwei Stunden an und hat keine Nachwirkungen. Die auffälligsten Symptome sind Taubheitsgefühle im Nacken, die sich allmählich in beide Arme und den Rücken ausbreiten, allgemeine Schwäche und Herzrasen.“ Kwok nannte das ganze China-Restaurant-Syndrom („Chinese restaurant Syndrome“),
Syndrom (vom grch. „syndrome“, das Zusammenlaufen, Zusammen-kommen; zu „syn“, zusammen, gleichzeitig + „dramein“, laufen): Störungs- oder Krankheitsbild, bestehend aus einer Reihe von Symptomen.
Symptom (über lat. „symptoma“ vom gleichbed. grch. „symptoma“, vorübergehender Zustand): für eine bestimmten Störung oder Krankheit charakteristische Veränderung; auch „Krankheitszeichen“.
Der New Yorker Neurologe Herbert Schaumburg nahm Kwoks Bericht zum Anlass, seinem eigenen Unbehagen in China-Restaurants auf den Grund zu gehen. Im Selbstversuch und mit Freiwilligen testete er morgens, mittags und abends chinesische Gerichte. Alle Zutaten wurden verdächtigt. Und er kam zu dem Schluss, dass Natriumglutamat mit großer Wahrscheinlichkeit die Ursache des China-Restaurant-Syndrom ist.
Glutamat-Freunde betonen seither immer und immer wieder, dass es bisher nicht gelungen sei, Glutamat unter streng kontrollierten, experimentellen Bedingungen als Ursache des China-Restaurant-Syndroms nachzuweisen. Angesichts all der Erfahrungsberichte drängt sich aber die Frage auf: Ist es bisher nicht gelungen, Glutamat als Ursache nachzuweisen, oder ist es bisher gelungen, Glutamat nicht als Ursache nachzuweisen? 174-178
Schaumburg, der sowohl die FDA wie die Babynahrungshersteller zu überzeugen versuchte, den „absolut unnötigen Nahrungszusatz“ wenigstens aus den Säuglings- und Kleinstkinderbreis zu verbannen, erhielt im März 1969 Unterstützung von – niemand anderem als - John Olney, als der die Berichte seiner Aspartat/Glutamat-Experimente veröffentlichte (siehe Seite 25) 171. Die US-Babynahrungshersteller verzichteten darauf hin freiwillig auf den Geschmacksverstärker. Die Tatsache, dass kleine Kinder noch keine Blut-Hirn-Schranke haben, die sie schützen könnte, war nicht zu leugnen. Das sah man auch in Deutschland so. Deshalb ist Glutamat in Babynahrung seither auch in Deutschland verboten.
Die FDA ließ eine ganze Reihe von Untersuchungen zum Thema Glutamat anstellen 174. Weitere Untersuchungen wurden empfohlen. Doch dann kam die Ära Rumsfeld.
Der FDA-Ausschuss für Lebensmittelüberempfindlichkeiten (FDA's Advisory Committee on Hypersensitivity to Food Constituents) stellte 1986 fest, dass Natriumglutamat keine Gefährdung der allgemeinen Öffentlichkeit darstelle, dass jedoch Reaktionen von kurzer Dauer bei manchen Leuten auftreten könnten. (Nach einer Studie, die bereits 1979 veröffentlicht worden war, sind das allerdings an die 40 % 178.)
Eine gemeinsame Expertenkommission für Lebensmittelzusatzstoffe der Lebensmittel- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (United Nations Food and Agriculture Organization) und der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization) wies Natriumglutamat 1987 der sichersten Kategorie von Lebensmittelzutaten zu.
Das Wissenschaftliche Komitee für Lebensmittel der Europäischen Gemeinschaft bestätigte 1991 erneut die Sicherheit von Natriumglutamat und klassifizierte die „akzeptable tägliche Zufuhr“ (ADI) als „nicht spezifiziert“, was die günstigste Kennzeichnung einer Lebensmittelzutat ausmacht. Das Komitee schrieb weiter: „Es hat sich gezeigt, dass Kinder, einschließlich Frühgeborener, Glutamat so effektiv verstoffwechseln wie Erwachsene und deshalb keinerlei besondere Empfindlichkeit bei erhöhter oraler Aufnahme von Glutamat zeigen.“ (Mit „verstoffwechseln“ ist „abbauen“ gemeint.)
Das Berliner Bundesamt für Risikobewertung, die zentrale nationale Kontaktstelle der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in Deutschland, hatte 2003 „keine Bedenken“ gegen die gelegentliche Verwendung geringer Mengen 178, 179. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung meinte gar, selbst beim häufigen Verzehr größerer Mengen sei „kein schädigender Einfluss“ zu erwarten.
Beide stützten sich auf die Ergebnisse der „Glutamat-Konferenz“ von 1996 unter Leitung des Hohenheimer Professors Hans Konrad Biesalski 178. Dort hatten Experten festgestellt, Glutamat stünde in „keinem Widerspruch zu einer gesunden Ernährung“ und habe „auch in hohen Dosen keine spezifischen Nebenwirkungen“. Wie sich später jedoch herausstellte, hatte das Treffen auf Wunsch des Glutamat-Weltmarktführers Ajinomoto stattgefunden, vermittelt vom Glutamat-Informationsdienst im hessischen Kronberg und bezahlt vom Verband der europäischen Glutamat-Hersteller (COFAG: Comité des Fabricants d'Acide Glutamique de la Communauté Européenne).
Eine Begebenheit am Rande der „Glutamat-Konferenz“, die etwas Licht auf ihre Expertengruppe wirft 178:
Experimentelle Studien werden meist nach einem einfachen Versuchsplan durchgeführt. Man arbeitet mit zwei Gruppen von Versuchspersonen. Die eine Gruppe, die „Versuchsgruppe“, erhält die zu prüfende Substanz, z. B. Glutamat. Die andere Gruppe, die „Kontrollgruppe“, erhält ein Placebo (es sieht aus wie die zu prüfende Substanz, hat aber keine Wirkung, z. B. Milcheiweiß). Dann stellt man fest, ob vermutete Wirkungen der zu prüfenden Substanz überzufällig der Versuchsgruppe zuzuordnen ist (es gibt dazu ein mathematisches Verfahren). Wenn das nicht der Fall ist, gilt die vermutete Wirkung der Substanz als nicht belegt.
Bei einem der Experimente, auf die sich die Experten beriefen, war das Placebo in Wirklichkeit jedoch kein Placebo, sondern ein anderer Geschmacksverstärker: Aspartam (Aspartam ist sowohl Süßungsmittel wie auch Geschmacksverstärker). Mit anderen Worten, man testete Glutamat versus Aspartam. Ein Ergebnis zugunsten oder ungunsten des einen oder anderen konnte dabei also kaum herauskommen.
Ein Versehen? Wie auch immer, man kann sich an die berüchtigten Aspartam-Studien von Searle aus den 60-er/70-er Jahren erinnert fühlen.
Die Gesetzgebung der Europäischen Union, seit Januar 2013 in Kraft, klassifiziert Natriumglutamat als Salzersatz, Würzmittel und Aroma mit einer maximalen Verzehrmenge von 10 g/kg Lebensmittel, ausgedrückt als Glutaminsäure.
Schweden hat sich derartigen Ideen nicht angeschlossen. In Schweden – das nicht Mitglied der EU ist und auch nicht an einem Freihandelsabkommen mit den USA interessiert - ist Natriumglutamat seit langem verboten.
Eine makabere Erfolgsgeschichte
Natriumglutamat ist auch eine sensationelle „Erfolgsgeschichte“. 1969 wurden weltweit 200.000 Tonnen verbraucht 119, 168, 171. 2003 waren es 1,5 Millionen, 2009 schon 2 Millionen Tonnen. Das entspricht ungefähr einer 3.300 km langen Lastwagenkolonne voll mit Natriumglutamat - von Berlin nach Moskau und zurück. (Was in „Hefeextrakten“, „Würzen“ und ähnlichem steckt, ist dabei nicht einmal berücksichtigt.) Das meiste davon wird nach wie vor in Asien verbraucht, immerhin 6 % sind es in Europa.
Natriumglutamat ist enthalten in Fleisch- und Gemüsebrühen, Suppenwürfeln, Tütensuppen, Gewürzmischungen, Kartoffel-Chips, Gemüsesäften, Fleisch- und Wurstwaren und den meisten Fertiggerichten aus dem Kühlfach oder aus der Dose, – in der „Hühnersuppe mit Nudeln“ von Knorr, in der „Chicken Noodle Soup“ von Campbell's, in vielen Maggi-Erzeugnissen, wie z. B. in der „Rindsbouillon“, der „Pastaria Spaghetti Bolognese“ oder der „Fünfminutenterrine“, in den meisten Schinken, in fast jeder Salami, in der Leberwurst, im Fleischsalat und in den „Chipsletten“ von Bahlsen 79, 171, 176, 178.
Natriumglutamat (oder „Mononatriumglutamat“) pur ist in jedem Asia-Laden zu haben. In Maggis „Fondor“ und „Maggi-Würze“ sind noch ein paar weitere Zutaten enthalten. Größere Mengen für den gewerblichen Bedarf halten Zulieferer der Lebensmittelindustrie bereit, lieferbar in den Standardkörnungen „sehr fein“, „fein kristallin“ und „mittel kristallin“ im 25-kg-Poly-/Papiersack auf vollen Paletten zu jeweils 750 kg, um „andere Aromen und Zutaten geschmacklich zu verstärken bzw. zu verbinden und damit abzurunden. Die Einsatzgebiete sind recht breit, denn es passt gut zu Fisch, Fleisch, Geflügel, sehr vielen Gemüsesorten, Suppen, Soßen, Dressings und Marinaden. Wichtig ist jedoch, dass exakt die richtige, rezepturindividuelle Dosierung gefunden wird, denn eine Überdosis an Mononatriumglutamat verdirbt den Geschmack eines jeden Gerichtes“ 180.
In der Zwischenzeit gibt es eine ganze Reihe von Geschmacksverstärkern. In der Liste der in der Europäischen Union zugelassenen Lebensmittelzusatzstoffe 143 finden wir:
E620 Glutaminsäure E634 Calcium-5'-ribonucleotid
E621 Natriumglutamat E635 Dinatrium-5'-ribonucleotid
E622 Monokaliumglutamat E640 Glycin und dessen Natrium-Salz
E623 Calciumdiglutamat E650 Zinkacetat
E624 Monoammoniumglutamat
E625 Magnesiumdiglutamat
E626 Guanylsäure
E627 Dinatriumguanylat
E628 Dikaliumguanylat
E629 Calciumguanylat
E630 Inosinsäure
E631 Dinatriuminosinat
E632 Dikaliuminosinat
E633 Calciuminosinat
Guanylsäure und Guanylate (Salze der Guanylsäure) ebenso wie Inosinsäure und Inosinate (Salze der Inosinsäure) wirken in salzhaltigen Lebensmitteln stark geschmacksverstärkend; in Mischungen mit Glutaminsäure wird ihre Wirksamkeit erhöht. Auch andere Zusatzstoffe werden als Geschmacksverstärker verwendet, z. B. E951 Aspartam und E961 Neotam. Als „echte“ Geschmacksverstärker jedoch gelten die Stoffe mit den Nummern E6xx (für die keinerlei ADI-Werte festgelegt worden sind) 181.
Geschmacksverstärker haben trotz aller „Unbedenklichkeit“ einen schlechten Ruf. Man hat deshalb auf „ein traditionelles Würzmittel in Bio-Lebensmitteln“ (Alnatura) zurückgegriffen: Hefeextrakt (Extrakt: vom lat. „extractum“, Auszug, eigentlich „das Herausgezogene“; zu „extrahere“, herausziehen) 182.
Hefen sind einzellige Mikroorganismen, die in der Lage sind, organische Stoffe abzubauen, ohne dass es zu Fäulnis kommt: zu „vergären“. Wenn bsw. Äpfel vom Baum fallen und eine Weile im Gras liegen, gehen sie zuerst in Gärung, dann in Fäulnis über.
Homo sapiens verwendet die Gärung seit jeher zur Verfeinerung seiner Lebensmittel, wobei er entweder natürlicherweise im Substrat vorhandene Hefen nutzt („Spontangärung“) oder gezüchtete Hefen zusetzt.
Wein war bis in die 1970-er Jahre ein Produkt der Spontangärung 183. Erst die großtechnische Erzeugung von Trockenhefe (Hefepulver) brachte das herkömmliche Verfahren ins Abseits. Der Wein entsteht, indem die Hefen den Zucker im Most zu Alkohol umwandeln. Hefen vermehren sich durch Sprossung (Teilung). Die Energie dazu liefert ihnen der Zucker. Der Alkohol ist somit eigentlich nur ein Nebenprodukt, das bei der Vermehrung der Hefen anfällt.
Im der englischen Stadt Burton upon Trent wird seit jeher eine Menge Bier getrunken und gebraut; und weil beim Bier Brauen eine Menge an Hefe anfällt, kam schon 1902 jemand auf die Idee, etwas Essbares aus den Abfällen zu machen 182. Marmiate heißt das Produkt, wird insbesondere als Brotaufstrich verwendet und gehört heute Unilever.
„Nur wenige Jahre nach der Entdeckung des Hefeprodukts als Lebensmittel in England, in den 1920-er Jahren, beginnt der Hefeextrakt seine Karriere im deutschen Reform- und heutigen Bio-Bereich. Der Chemiker Karl von Dormagen entwickelte eine schonende Methode, Hefe zu extrahieren und als Lebensmittel zu verarbeiten. Und genau dieser Hefeextrakt ist seit Jahrzehnten beliebt bei vielen Anhängern der Reformbewegung, bei Vegetariern und Veganern“ (Alnatura. Hervorhebung nicht im Original). Der Hefeextrakt ist also älter als der Geschmacksverstärkers Natriumglutamat – und gehört pikanterweise in die Tradition der Biolebensmittelhersteller.
Alnatura klärt auf: „Die Salze der Glutaminsäure in ihrer isolierten Form sind als Zusatzstoffe ,Geschmacksverstärkerʻ definiert. Der bekannteste unter ihnen ist Mononatriumglutamat. Der Einsatz von diesen Geschmacksverstärkern ist in Bio-Produkten verboten. Manche Kunden wünschen einen Verzicht auf Hefeextrakt in Bio-Lebensmitteln. Alnatura deklariert alle Zutaten auf den Produktverpackungen. So hat man die Möglichkeit, sich nach Lebensmitteln gemäß den eigenen Vorlieben zu entscheiden – zum Beispiel für eine Gemüsebrühe mit oder ohne Hefeextrakt“.
Der Text ist arg holprig. Kein Wunder. Kein Wort über die Ähnlichkeiten zwischen Geschmacksverstärkern und Hefeextrakt. Verbindliche Worte darüber, dass Alnatura alle Zutaten auf Produktverpackungen deklariert. Doch das ist Alnaturas Pflicht. Kaschierende Worte über die Möglichkeit, sich für die eine oder andere Gemüsebrühe entscheiden zu können. Doch vielleicht möchte man sich gar nicht nach „Vorlieben“ entscheiden, sondern Gesundheitsrisiken!
Die Herstellung von Hefeextrakt ist simpel. Im großen und ganzen hat sich im Laufe der Zeit nicht viel daran geändert:
„Der Chemiker Karl von Dormagen entwickelte eine schonende Methode, Hefe zu extrahieren.“ „Bio-Hersteller setzen auf eine besonders schonende Extraktion der Hefe.“ Und schließlich wird das ganze „schonend konzentriert“.
Das Verfahren, abseits aller „Schonung“: Man nimmt besonders eiweißreiche Hefe, speziell gezüchtete Heferassen, insbesondere Backhefe, aber auch Bierhefe, Molkehefe (aus der Milchverarbeitung) oder Futterhefe (aus dem Tierfuttermittel-Katalog) 182, 184. Die Organismen werden abgetötet, z. B. indem man sie mit etwas Kochsalz im Wasser erwärmt. Die Zellen (Hefen sind Einzeller) werden durch zelleigene Enzyme und möglicherweise zugesetzte Enzyme aufgeschlossen. Der Zellsaft wird freigesetzt, von unlöslichen Bestandteilen getrennt, aufkonzentriert und eventuell sprühgetrocknet („zerstäubungsgetrocknet“). Auf diese Weise wird ein Trockensubstanzgehalt von 70 bis 80 % bei Pasten und 95 bis 97 % bei Pulver erreicht (siehe Abbildung 8).
Hefeextrakt schmeckt nicht nach Hefe 184. Er hat eher einen würzigen Geschmack „und wird als Brotaufstrich, Würzmittel und Geschmacksverstärker … verwendet.“ Was den „vielen Anhängern der Reformbewegung“ wahrscheinlich nicht bekannt war, ist die Ursache des eigenartigen Wohlgeschmacks - „Umami“ nennt ihn auch Alnatura 182. Analysen zeigen, dass der Extrakt fast die ganze Reihe der bekannten Aminosäuren enthält, angeführt von Glutaminsäure und – siehe da – Asparaginsäure. In einem Beispiel sind Glutaminsäure mit ca. 12 % und Asparaginsäure mit ca. 8 % vertreten, machen also insgesamt ca. 20 % des Extrakts aus. Natürlich sind auch Guanylsäure und Inosinsäure (siehe oben) vertreten. Hefeextrakt ist aber, wie Hefe, reich an B-Vitaminen – was durchaus als Vorteil anzuerkennen ist.
Abb. 8: Dickflüssiger Hefeextrakt.
Der Zusatz von Glutaminsäure oder Natriumglutamat muss im Verzeichnis der Zutaten entweder als „Geschmacksverstärker E620“ oder „Geschmacksverstärker Glutaminsäure“ bzw. „Geschmacksverstärker E621“ oder „Geschmacksverstärker Natriumglutamat“ angegeben werden. Mischprodukte mit einem hohen Anteil an Aminosäuren, u. a. Glutaminsäure und Asparaginsäure, gelten jedoch nicht als Geschmacksverstärker.
Hefeextrakt hat deshalb den Vorteil für den Lebensmittelhersteller, dass er auf die unattraktive Deklaration „Geschmacksverstärker“ verzichten kann 170, 181, 184. Er darf sogar Clean Labelling (engl. saubere Deklaration) betreiben und ausdrücklich damit werben, keinen Geschmacksverstärker einzusetzen.
Knorr (eine Tochter des niederländisch-britischen Unilever-Konzerns) und Maggi (der Schweizer Nestlé AG zugehörig) haben bereits Anwendungsbeispiele geliefert V4.
„Knorr Fix Zart & Saftig Saftiger Krustenbraten“, ein „Fix-Produkt“ zur Zubereitung von Krustenbraten enthält 2009 die Aufschrift: „Guter Geschmack ist unsere Natur. Natürlich ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe – Konservierungsstoffe – Farbstoffe“. Auf der Zutatenliste finden wir allerdings den besagten Hefeextrakt.
Auf einer Tüte mit der Aufschrift „Maggi fix und frisch. Ungarisches Gulasch“ finden wir 2012 gar ein Siegel: „100 % Geschmack. Geschmacksgarantie. Ohne Zusatzstoff Geschmacksverstärker.“ Und auf der Zutatenliste steht wieder der Hefeextrakt.
Auf Maggis Website lesen wir:
„Das Qualitätsversprechen von MAGGI.
Produkte von MAGGI stehen seit jeher für Genuss auf hohen Qualitätsniveau. Sie werden mit großer Sorgfalt und unter dem Grundsatz hergestellt, Ihnen Lebensmittel zu bieten, die Sie bedenkenlos genießen können und die einfach gut schmecken. MAGGI forscht unermüdlich, um seine Produkte für Sie immer weiter zu verbessern – für eine genussvolle und abwechslungsreiche Ernährung für die ganze Familie.“
Weiter unten, zum Qualitätssiegel:
„Genuss ohne Zusatzstoff Geschmacksverstärker
Aktuell ist es unter Bestreben, Ihnen den größtmöglichen Genuss beim Essen, bsw. auch ohne den Zusatzstoff Geschmacksverstärker zu bieten. Für jedes Produkt, das das hier abgebildete Siegel trägt, bietet MAGGI Ihnen ein 100-prozentiges Geschmackserlebnis ohne den Zusatzstoff Geschmacksverstärker.
Immer mehr Verbraucher legen Wert darauf, Lebensmittel ohne Zusatzstoffe zu sich zu nehmen. Ihren Wünschen kommt MAGGI konsequent nach. Heute sind bereits bei ca. 70 Prozent der MAGGI Rezepturen keine geschmacksverstärkenden Zusatzstoffe wie Mononatriumglutamat enthalten.“
In der Zwischenzeit hat es sich aber herumgesprochen, dass Hefeextrakt nicht unbedingt das ist, wonach es sich anhört; und es sieht fast so aus, als hätten die Lebensmittelhersteller angefangen, die geschmacksverstärkenden Stoffe in allerlei Zutaten zu „verstecken“ 117, 185, 186. Der Gesetzgeber macht es ihnen möglich, weil die Stoffe nur in ihrer isolierten Form deklariert werden müssen; und die Natur kommt ihnen entgegen, weil die Stoffe in allen eiweißhaltigen Pflanzen enthalten sind.
Die geschmacksverstärkenden Stoffe sind freie (nicht in Eiweiß-Moleküle eingebaute) Aminosäuren. Man erhält sie, indem man die Moleküle aufbricht (oder „auflöst“). Ein gängiges Verfahren dazu ist die Hydrolyse (vom grch. „hydor“, Wasser + „lysis“, Lösung, Auflösung): die Spaltung chemischer Verbindungen durch ihre Reaktion mit Wasser 187. Die Rede ist dann von hydrolysierten Eiweißen oder hydrolysierten Gemüseproteinen.
Weizen enthält das weitaus meiste Klebereiweiß (Gluten) aller Getreidearten. 100 g Gluten enthält mehr als 30 g Glutaminsäure. Maggi verwendet deshalb ausschließlich Weizenproteine (früher auch Proteine aus Sojabohnen) für seine Maggi-Würze 188. Es ist also nicht verwunderlich, wenn hohe Konzentrationen der geschmacksverstärkenden Stoffe auch in Weizenprotein und Sojaextrakt zu finden sind. Das Kasein der Kuhmilch ist ebenfalls reich an Glutaminsäure. Daher finden wir auch ein Trockenmilcherzeugnis oder Milcheiweiß auf der einen oder anderen Zutatenliste.
Auch Würze oder Gewürze sind zulässige „Verstecke“. Besonders krass: Aroma darf bis zu 30 % Glutamat enthalten, ohne dass es deklariert werden muss 186, 189. Es gibt noch eine Menge mehr Möglichkeiten, geschmacksverstärkende Stoffe in Lebensmitteln unterzubringen, ohne „Geschmacksverstärker“ angeben zu müssen. Im obigen finden Sie nur die „Spielregeln“ dazu.
Die beschriebenen Deklarierungen verstoßen nach allgemeiner Auffassung nicht gegen geltendes Recht. Zweifel sind jedoch sicherlich angebracht, ob sie wirklich im Sinne des Gesetzes sind. In der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. Dezember 20018 über Lebensmittelzusatzstoffe 190 finden wir dazu:
„Artikel 6
Allgemeine Bedingungen für die Aufnahme
von Lebensmittelzusatzstoffen in die Gemeinschaftsliste
und für die Verwendung der Lebensmittelzusatzstoffe
(1) Ein Lebensmittelzusatzstoff darf nur in die Gemeinschaftslisten in den Anhängen II und III aufgenommen werden, wenn die folgenden Voraussetzungen und gegebenenfalls andere berücksichtigenswerte legitime Faktoren — einschließlich umweltrelevanter Faktoren — erfüllt sind:
a) der Lebensmittelzusatzstoff ist bei der vorgeschlagenen Dosis für die Verbraucher gesundheitlich unbedenklich, soweit die verfügbaren wissenschaftlichen Daten ein Urteil hierüber erlauben,
b) es besteht eine hinreichende technische Notwendigkeit, und es stehen keine anderen wirtschaftlich und technisch praktikablen Methoden zur Verfügung, und
c) durch die Verwendung des Lebensmittelzusatzstoffs werden die Verbraucher nicht irregeführt.“
(Hervorhebung nicht im Original. In den Anhängen II und III sind die verschiedenen Zusatzstoffe aufgelistet.) Wir sehen also, dass der Gesetzgeber sehr wohl Vorkehrungen getroffen hat, dass die Verbraucher nicht irregeführt oder betrogen werden.
In Kanada gilt eine andere Auffassung 174. Die Canadian Food Inspection Agency (Kanadische Lebensmittelaufsicht) betrachtet Deklarierungen wie „no MSG“ (MSG: kurz für „monosodium glutamate“, Mononatriumglutamat) oder „MSG free“ als irreführend und betrügerisch, wenn andere Quellen von freiem Glutamat vorhanden sind. Zumindest Clean Labelling ist demnach also nicht mehr erlaubt.
Hinter dem China-Restaurant-Syndrom
Glutaminsäure ist der hauptsächliche erregende Überträgerstoff im zentralen Nervensystem (vgl. S. 33) 117. Glutaminsäure und ihre „kleine Schwester“ Asparaginsäure können sich im Gehirn jedoch gegenseitig ersetzen. Man spricht in diesem Zusammenhang meist allerdings von Glutamat bzw. Aspartat.
Zur Verwendung der Begriffe siehe Abbildung 9: Glutaminsäure liegt „unter physiologischen Bedingungen“, das heißt im Körper, gewöhnlich als „Zwitterion“ vor 165. Das Molekül weist zwei negative Ladungen und eine positive Ladung auf. Es kann also je nach Situation als Anion (negative geladenes Ion) oder als Kation (positiv geladenes Ion) reagieren. Diese Form der Glutaminsäure wird meistens Glutamat genannt.
Glutamat steht aber auch für eine bestimmte Art von Verbindung der Glutaminsäure: „das Salz der Glutaminsäure“. Das bekannteste ist Natriumglutamat; und auch das nennt man oft kurz Glutamat. In der wässrigen Lösung verflüchtigt sich das Natrium-Ion (ganz unten) und was bleibt, ist das Zwitterion Glutamat.
Es kommt also darauf an, in welchem Zusammenhang das Wort „Glutamat“ verwendet wird. Entsprechendes gilt für das Wort „Aspartat“.
Abb. 9: Ganz oben Summen- und Strukturformel der Glutaminsäure als solcher. Darunter beide Formeln für Glutaminsäure/Glutamat, wie es im Körper vorkommt. Darunter die Formeln für Natriumglutamat als solches. Ganz unten Natriumglutamat, in Wasser gelöst. Rot die Ladungen des Ions.
Ohne Glutamat/Aspartat könnten Menschen weder sehen, hören, empfinden, fühlen, erkennen, erinnern, denken, sprechen, laufen - noch irgendwas. Doch was geschieht, wenn zu viel davon im Blut schwimmt?
John Olney führte die wesentlichen Tierversuche dazu durch 164, 171, 176, 191. Die ersten stammen aus dem Jahr 1969. Dabei spritzte er neugeborenen Mäusen und Ratten über fünf Tage hinweg Glutamat unter die Haut. Danach stellte er fest, dass Neuronen in bestimmten Hirnregionen (am Boden der Hirnrinde) 191 abgestorben waren und kleine Hohlräume hinterlassen hatten. Später wurden die Tiere fettleibig, und sie entwickelten Diabetes und Herzkrankheiten. Bei weiteren Experimenten beobachtete er die gleichen Hirnschäden auch bei Affen, denen er Glutamat verabreicht hatte. Olney war insgesamt an ca. 120 Experimenten dieser Art zu Glutamat und Aspartam/Aspartat beteiligt.
Das China-Restaurant-Syndrom ist also nicht, worum es hier geht – auch wenn es sehr unangenehm für die Betroffenen werden kann. Es ist nicht mehr und nicht weniger als ein Hinweis auf die Auswirkungen von Glutamat. Olney produzierte die Hirnschäden bei seinen Versuchstieren mit starken Überdosen in kurzer Zeit. Die Frage ist hier, wie sich geringere Dosen über lange Zeit hinweg beim Menschen auswirken.
Die Wege der Nervenbahnen
Der Mensch – wie jedes andere tierische Lebewesen auch – steht über Sinneswahrnehmungen mit seiner Umwelt und seinem eigenen Körper in Kontakt. Körperliche Grundlage der Sinneswahrnehmungen ist das Nervensystem. Beim Nervensystem handelt es sich – wie zum Teil auch bei der Muskulatur – um ein elektrisches System. Es beruht darauf, dass die Zelle eine Spannung gegenüber ihrer Umgebung aufweist.
Abb. 10: Unterschiedliche Verteilung von Ionen im Extra- und Intrazellularraum. Na+ = Natrium, K+ = Kalium, Ca++ = Calcium, Cl- = Chlor, HCO3- = Hydrogencarbonat). Darunter jeweils die Zahl der Masseeinheiten.
Die Spannung kommt dadurch zustande, dass positiv und negativ geladene Ionen innerhalb und außerhalb der Zelle verschieden verteilt sind. Innen (im „Intrazellularraum“) sind mehr negativ geladene Ionen bzw. negative Ladungen vorhanden als außen (im „Extrazellularraum“). Die Spannung beruht in erster Linie auf großen, negativ geladenen Eiweiß-Molekülen. Sie stammt des weiteren von einer Reihe kleinerer Ionen (zu letzteren siehe Abbildung 10) Die Nervenzelle weist deshalb im Ruhezustand eine negative Spannung gegenüber ihrer Umgebung auf. Beim Menschen sind es durchschnittlich etwa 70 mV (Millivolt = Tausendstelvolt) – die bei der Leiche verschwinden.
Die Spannung im Ruhezustand ist das Ruhepotential der Nervenzelle. „Potential“ heißt, dass potentiell eine Reaktion ausgelöst oder Arbeit geleistet werden kann. Das Ruhepotential des Apfels wird frei, wenn er zu Boden fällt. Das Ruhepotential der Nervenmembran leistet Arbeit, wenn es einen Impuls - entweder auf direktem Wege oder über das Rückenmark - zum Gehirn schickt. Es wird zum Aktionspotential.
Aktionspotentiale werden an den Kontaktstellen des Nervensystems mit der Umgebung in Gang gesetzt: sogenannten Sensoren (vom lat. „sentire“, wahrnehmen, empfinden; eigentlich „Wahrnehmer“) 192, 193. Es sind zum einen Teil einfach Nervenendigungen, die äußere Einwirkungen in elektrische Impulse (Aktionspotentiale) umwandeln und diese nach zentral weiterleiten. Dazu gehören die Sensoren der Geruchsnerven in der Nasenschleimhaut, der Nerven des Tastsinns in der Haut und der Nerven der Schmerzempfindung fast überall im Körper. Es sind zum anderen Teil eigene, spezielle Nervenzellen, die der impulsleitenden Nervenzelle vorgeschaltet sind. Dazu zählen die Sensoren der Seh-, Hör- und Geruchsnerven – sie sind zu Sinnesorganen zusammengefügt. Beiden Arten von Sinneszellen gemeinsam ist, dass sie äußere Einwirkungen, z. B. Licht, Schall oder Druck, aufnehmen und zu elektrischen Impulsen machen. Die Aufmerksamkeit des Menschen geht nach außen/peripher; die elektrischen Impulse laufen nach innen/zentral.
Das Ruhepotential der Nervenzelle ist eine nicht allzu stabile Angelegenheit, die ständiger Korrektur bedarf. Ein elektrischer Impuls ausreichender Stärke kann sich deshalb so auf die Membran auswirken, dass sie für kleine Ionen durchlässig wird. Sie schlüpfen durch Poren in der Membran, jeweils in der Richtung, die zu einem Ausgleich, der unterschiedlichen Verteilung führt. Die negative Spannung dreht sich schnell um, schießt über den Null-Punkt hinaus in den positiven Bereich und kehrt langsam zur Ausgangsspannung zurück. Das ganze ist ein Zyklus des Aktionspotentials. Es läuft die Nervenfaser entlang wie die Welle an der Oberfläche des Sees, in den Sie einen Stein geworfen haben.
Wenn das Aktionspotential am anderen Ende der Nervenzelle einläuft, verursacht es dort, dass „Quanten“ (Portionen) des verwendeten Überträgerstoffs (im Gehirn z. B. Glutamat) in den synaptischen Spalt abgegeben werden (siehe Abbildung 11). Der Überträgerstoff ist in Vesikeln (vom lat. „vesicula“, Verkleinerungsform von „vas“, Gefäß; auch „Speicherbläschen“) der präsynaptischen Endigung (lat. „prae“, vor) gespeichert. Ein Quant entspricht dem Inhalt eines Vesikels. Der Überträgerstoff wird auf der anderen Seite – der postsynaptischen Endigung (lat. „post“, nach) - von Rezeptoren aufgenommen und lässt das Aktionspotential in der nachfolgenden Zelle weiterlaufen.
Überschüssiges Glutamat wird schnell wieder in die Vesikel der präsynaptischen (oder „vorsynaptischen“) Endigung zurückgeholt oder in Gliazellen der Umgebung (grch. „glia“, Leim: Bindegewebe des Gehirns) gelagert, wo es in das ungiftige („atoxische“) Glutamin umgewandelt wird 194. Das Glutamin wird bei Bedarf in die vorsynaptische Endigung transportiert und wieder zu Glutamat umgebaut.
Abb. 11: Synapse.
Das Aktionspotential wird in erster Linie durch einen schnellen Einstrom von Natrium-Ionen (Na+) ausgelöst. Das Innere ist gegenüber dem Äußeren der Zelle negativ geladen; und entgegengesetzte Ladungen ziehen sich an. Im Inneren gibt es zudem viel weniger Na+ als im Äußeren. Also strömt Na+ in die Zelle, sobald die entsprechenden Kanäle geöffnet werden.
Der rasche Einstrom führt zu einer Umpolung („Depolarisation“) der Spannung (siehe Abbildung 12). Drinnen gibt es nun mehr Na+ als draußen. Das Innere ist nun positiv gegenüber dem Äußeren der Zelle geladen. Die Natrium-Kanäle schließen sich.
Im Inneren der Zelle gibt es umgekehrt von Anfang an mehr an Kalium-Ionen (K+) als im Äußeren. Deshalb öffnen sich nun die Kalium-Kanäle, noch während sich die Natrium-Kanäle schließen. Entgegengesetzte Ladungen ziehen sich wie gesagt an, ungleiche Konzentrationen streben danach, sich auszugleichen: also strömt K+ nach draußen. Es kommt zu einer Rückpolung („Repolarisation“) der Spannung.
Die Spannung schießt wieder über – nun weniger stark und in die andere (negativen) Richtung („Hyperpolarisation“). Die Kalium-Kanäle schließen sich. Das Ruhepotential stellt sich wieder ein – das ja durch die (ortsfesten) negativ geladenen Eiweiß-Moleküle im Zellinneren festgelegt ist.
Abb. 12: Aktionspotential.
Die Ionen wandern nicht einfach durch die Membran. Dazu sind sie zu groß. Es gibt vielmehr eine Reihe von Membran-Proteinen, die ihren Durchtritt regeln. Grundsätzlich sind zwei Arten davon zu unterscheiden 196, 197.
Zum einen haben wir Ionenkanäle (auch „Kanalproteine“), über die Ionen, dem Potential- und Konzentrationsgefälle folgend, in die Zelle hinein oder aus der Zelle hinaus gelangen (siehe Abbildung 11) 196,. Man spricht von „passivem Transport“. Manche Kanäle sind spannungsgesteuert; sie werden durch die an der Membran anliegenden Spannung geöffnet oder geschlossen (dazu gehören die oben erwähnten Natrium- und Kalium-Kanäle). Andere werden durch den verwendeten Überträgerstoff gesteuert; wenn der Überträgerstoff am dafür vorgesehenen Rezeptor am Eingang des Kanals bindet, öffnet oder schließt sich das Tor (dazu weiter unten mehr). Ionenkanäle sind wesentlich am Ablauf des Aktionspotentials beteiligt.
Zum anderen haben wir Transport-Proteine (siehe Abbildung 11) 197. Sie transportieren Ionen entgegen dem Potential-/Spannungsgefälle durch die Membran. Man spricht von „aktivem Transport“. Oft befördern sie gleichzeitig Ionen aus der Zelle heraus und Ionen in die Zelle hinein, wie z. B. die „Natrium-Kalium-Pumpe“: in einem Arbeitsgang werden jeweils drei Natrium-Ionen aus der Zelle heraus und zwei Kalium-Ionen in die Zelle hinein befördert. Transport-Proteine stellen den ursprünglichen Zustand des Ruhepotentials wieder her.
Erregung und Hemmung
Synapse ist nicht gleich Synapse. Das Nervensystem wird durch „Verstärker“ und „Hemmer“ moduliert. Der verstärkende bzw. hemmende Effekt wird durch verschiedene Überträgerstoffe und ihre Rezeptoren produziert. Sie bilden erregende („exzitatorische“: vom lat. „excitare“, erregen) bzw. hemmende („inhibitative“: vom lat. „inhibere“, hemmen) Systeme.
Das Aktionspotential funktioniert nach dem Alles-oder-nichts-Prinzip. Es läuft entweder ab oder nicht. Die Stärke der Spannungsveränderung („Amplitude“) ist immer gleich. Doch ihre Anzahl innerhalb einer gegebenen Zeit („Frequenz“) variiert, je nachdem wie oft die Schwellenspannung (siehe Abbildung 12) erreicht wird – die die Spannungsveränderung auslöst. Exzitatorische Systeme verstärken von Wahrnehmungen oder Denkvorgängen stammende Impulse, so dass sie verarbeitet werden können; und sie verstärken motorische Impulse, so dass am Ende der Bahn Muskelkontraktionen geschehen. Inhibitorische Systeme gehören meist zwischengeschalteten Neuronen („Interneuronen“) an; wenn zu hohe Impulsfrequenzen ankommen, werden sie auf ein tolerierbares Niveau reduziert 198.
Glutamat, der hauptsächliche erregende Überträgerstoff, hat seinen Gegenspiel in GABA (kurz für eng. „Gamma Amino Butter Acid“, Gamma-Amino-Buttersäure), dem wichtigsten hemmenden Überträgerstoff im zentralen Nervensystem (ZNS) 198. GABA wirkt in erster Linie an der präsynaptischen Endigung des Interneurons, in dem es die Freisetzung des erregenden Überträgerstoffs (meist Glutamat) hemmt. Es hat entspannende, schmerzlindernde, blutdruckstabilisierende, krampfhemmende und angstlösende Wirkungen.
GABA hat nach Glutamat die zweithöchste Konzentration aller Überträgerstoffe im ZNS. Beide werden aus derselben Aminosäure-Vorstufe gebildet. Glutamin wird zu Glutamat oxidiert. Glutamat wird zu GABA umgewandelt. GABA kann nicht direkt aus Glutamin hergestellt werden.
Glutamat wirkt über spezifischen Rezeptoren der postsynaptischen Membran. Gegenwärtig sind fünf verschiedene Arten von Glutamat-Rezeptoren bekannt 199, 200. Als wichtigster gilt der sogenannte NMDA-Rezeptor – benannt nach einem Stoff, der im menschlichen Körper gewöhnlich nicht vorkommt, im Experiment aber zur Aktivierung des Rezeptors führt 201.
Der NMDA-Rezeptor ist ein relativ großes membranständiges Eiweiß-Molekül, in dem mindestens sechs Bindungsstellen für Glutamat sowie verschiedene andere, mitwirkende Stoffe und ein Ionenkanal, potentiell durchlässig insbesondere für Calcium, integriert sind 200-206. Die kritischen Reaktionen:
- Im Ruhezustand (wenn kein Aktionspotential ankommt), befindet sich das Neuron sozusagen „in Bereitschaft“ (Das ist das Ruhepotential.) Im Inneren des Neurons ist die Konzentration an Calcium-Ionen (Ca2+) nur gering. Das heißt, die Schwelle für ankommende Aktionspotentiale ist niedrig. (Die Schwelle wird ja durch positive Ladungen angehoben.) Der Ionenkanal ist durch ein Magnesium-Ion (Mg2+) blockiert.
- Läuft ein Aktionspotential durch das präsynaptische Neuron, wird am Ende Glutamat in den synaptischen Spalt ausgeschüttet. Das Glutamat bindet am NMDA-Rezeptor des postsynaptischen Neurons. Das Magnesium-Ion verschwindet aus dem Ionenkanal. Der Kanal öffnet sich, und Ca2+ strömt in die Zelle. Das Schwellenpotential - und damit die Reaktionsbereitschaft der Zelle - wird erhöht.
- Ständig überhöhte Glutamat-Konzentrationen im synaptischen Spalt führen zu ebenso überhöhten,
krankhaften Calcium-Konzentrationen in der Zelle. Das Schwellenpotential wird chronisch erhöht. Es entsteht Exzitotoxizität (vom lat. „excitatre“, erregen + grch. „toxikos“,
Gift; auch „Erregungstoxizität“): eine Abfolge von Reaktionen, an deren Ende der Untergang der Nervenzelle steht.
Calcium hält das Membranpotential übermäßig hoch, was dazu führt, dass sich Arachidonsäure bildet, die wiederum Ausgangspunkt für eine ganze Reihe weiterer Stoffe ist 207-209. Sie bilden die sogenannte Arachidonsäure- Kaskade, die einen der hauptsächlichen Signalübertragungswege für Schmerzen und Entzündungen darstellt. Währenddessen werden vermehrt freie Radikale gebildet, u. a. das hochgiftige Peroxinitrit (vgl. die Nummer 4 dieser Artikelreihe). Nervenzellen entzünden sich, werden geschädigt und sterben schließlich ab.
Eine gewisse Menge an Glutamat ist stets in den Vesikeln der präsynaptischen Endigung vorhanden. Eine gewisse, sehr viel kleinere Menge ist immer auch in der Synapse zu finden. Bereits geringe Überschreitungen der physiologischen (unter natürlichen Umständen vorhandenen) Mengen wirken jedoch toxisch. (Deshalb wird in der Synapse vorhandenes überschüssiges Glutamat rasch wieder in die Vesikel der vorsynaptischen Endigung zurückgeholt oder in Form von Glutamin in den Gliazellen gelagert.)
Die Blut-Hirn-Schranke hält Glutamat und Aspartat nur teilweise zurück 210, 117. Die Hirnspiegel steigen bei dauerhaftem Konsum um ca. 30 bzw. 60 %. Der Mensch speichert im übrigen fünfmal mehr als die Maus und hält die Blutspiegel wesentlich länger. Kinder sind zudem viermal sensibler als Erwachsene.
Die akuten Symptome eines Glutamat-Überschusses sind zum Teil als China-Restaurant-Syndrom bekannt: Herzrasen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Missempfindungen im Hals (im Bereich der Mandeln), Hautrötungen und -ausschläge, innere Unruhe, Rededrang, Zappeligkeit u. ä.
Die Glutamat-Ladungen brauchen vier bis sechs Stunden, um das Gehirn zu erreichen 211. „Das wird am besten durch die ,Schlafstörungenʻ der Leute illustriert und ihre Neigung, zwischen eins und zwei am Morgen aufzuwachen, nachdem sie die betreffenden Lebensmittel zwischen sieben und acht am Abend zu sich genommen haben. Erstaunlicherweise beträgt das Intervall zwischen Fressen und epileptischem Anfall beim Hund (ohne Medikamente) konstant zwischen vier und sechs Stunden“ (John Symes).
Es sind die Gliazellen, die die Glutamat-Konzentration an der Synapse kontrollieren. Wenn sie zugrundegehen, kann sich das Glutamat im synaptischen Spalt ansammeln und die Zelle, die es erhält, überrestimulieren oder zerstören 211.
Als chronische Symptome beobachteten wir bei Kindern Hyperaktivität und das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom – möglicherweise Vorboten einer Epilepsie. Auch das Autismus-Problem gehört hierher 212.
Glutamat ist ein Hauptgrund für Übergewichtigkeit sowohl bei Kindern wie auch Erwachsenen 213, 214. Es sollte niemanden verwundern; Glutamat ist auch als Zusatzstoff in Futtermitteln zugelassen 170. Es steigert den Appetit der Masttiere. Sie fressen weiter, nachdem sie schon gesättigt sind, und legen schnell an Gewicht zu. Der Effekt ist auch bei Menschen zu Genüge nachgewiesen.
Der Untergang des Sehnervs ist Ursache des Glaukoms (auch „grüner Star“): weltweit eine der häufigsten Erblindungsursachen 213, 215. Am weitesten verbreitet ist es jedoch in Asien, wo ja das meiste Glutamat in Form von Geschmacksverstärkern konsumiert wird.
Aristoteles prägte das Wort „Glaukom“ („glaukoma“, zu „glaukos“, bläulich glänzend) im 4. Jahrhundert v. Chr. nach der Verfärbung der chronisch entzündeten Regenbogenhaut des Auges, die ihn an das Meer erinnerte. „Star“ ist seit dem 8. Jahrhundert eigentlich eine Bezeichnung für Linsentrübungen. Und aus „bläulich glänzend“ wurde im 16. Jahrhundert im Norden Frankreichs „grün“, weil der Atlantik den Medici eher grünlich als bläulich erschien 215.
Wenn das Schmerzzentrum im Gehirn überrestimuliert wird, kommt es zu chronischen Muskelschmerzen: Fibromyalgie (siehe S. 34). Überrestimulationen motorischer Bahnen können zu epileptischen Anfällen und sogar zum sofortigen Tod durch Atemlähmung führen 214, 216.
Die Endstadien menschlichen Daseins sind oft weniger dramatisch. Erhöhte Glutamat-Hirnspiegel gehen mit dem Restless-Legs-Syndrom (Syndrom der ruhelosen Beine) und damit verbundenen Beschwerden einher 217, 218. „Die schleichende, stille Wirkung der neuronalen Erregungs-Toxizität wird eindrucksvoll an Alzheimer-, Parkinson- und Schlaganfall-Patienten demonstriert“ (Peter Rosler; Hervorhebungen nicht im Original) 119. Im Falle von Alzheimer- und Parkinson-Krankheit gibt es neben einem Glutamat-Überschuss auch einen Acetylcholin- bzw. Dopamin-Mangel (zwei weitere Überträgerstoffe) und einen Untergang der entsprechenden Systeme.
Es gibt also eine ganze Menge an maßgeblich glutamat-/aspartat-verursachten Erkrankungen. Das Spektrum lässt sich aber leicht überblicken, wenn man sich die grundlegenden Funktionen und Strukturen des Nervensystems ansieht.
Das Nervensystem kann auf verschiedene Weise unterteilt werden. Der Lage nach können wir das zentrale Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) vom peripheren Nervensystem (der Rest) abgrenzen. (Auf Seite 51 ff. haben wir Impulse von Sensoren des peripheren Nervensystems auf ihrem Weg ins zentrale Nervensystem verfolgt.)
Der Impulsrichtung nach können wir zwischen sensorischem (vom lat. „sentire“, wahrnehmen, empfinden) und motorischem (vom lat. „movere“, bewegen) Nervensystem unterscheiden. Die Impulse des sensorischen Systems laufen von peripher nach zentral (afferent: vom lat. „afferre“, herantragen), die Impulse des motorischen Nervensystems von zentral nach peripher (efferent: vom lat. „efferre“, heraus-, hinaustragen). Die afferenten Impulse gehen einher mit Wahrnehmungen und deren Verknüpfungen im Denken. Sie werden im Gehirn verschaltet und früher oder später auf efferente Bahnen geleitet. Die efferenten Impulse bewegen die Organ- und die Skelettmuskulatur. Das ist im Grunde das Bewegungs-Prinzip des Lebens.
Sowohl die sensorischen wie auch motorischen Systeme des Gehirns arbeiten mit Glutamat/Aspartat. Überhöhte Hirnspiegel können daher beide betreffen – und damit Wahrnehmung/Denken auf der einen und Bewe-gung auf der anderen Seite.
Zur idiopathischen Epilepsie
John Symes schreibt: „Eine meiner ersten und dramatischsten Entdeckungen … in Sachen Ernährung war, wie phantastisch Fälle von idiopathischer Epilepsie auf bestimmte Ausschlussdiäten ansprechen ...“
Idiopatisch: vom grch. „idios“, eigen + „pathos“, Krankheit: ein Begriff, der in der Medizin gern verwendet wird, wenn es keine erkennbare Ursache, wie bsw. eine Hirnverletzung, für eine Krankheit gibt – wenn sie sozusagen eigenständig entstanden zu sein scheint.
„ … Ich hatte gerade angefangen, mich mit der Zöliakie zu beschäftigen, als ich auf Berichte über epileptische Kinder mit Glutenunverträglichkeit stieß, die signifikante Verbesserungen zeigten, wenn sie glutenfreie Kost erhielten … Ich las auch, dass Mononatriumglutamat und Aspartam als Auslöser von epileptischen Anfällen bei Kindern identifiziert worden waren. Bald wurde mir klar, dass Gluten voll beladen ist mit den beiden nichtessentiellen nervenstimulierenden Aminosäuren Glutamat (Glutaminsäure) und Aspartat (Asparaginsäure). ,Könnte es so einfach sein?ʻ fragte ich mich ...
… Der allererste epileptische Hund, den ich auf glutenfrei Kost setzte, war innerhalb von 28 Stunden anfallsfrei. Meine Erwartungen übertreffend, zeigte jeder einzelne Fall von idiopathischer Epilepsie, der glutenfreie Kost erhielt (und auch einige Fälle von Hirntumoren), eine signifikante Reaktion. Und mit ein wenig mehr an Nachforschungen war ich bald in der Lage festzustellen, was notwendig war, um die Anfälle auch derjenigen vollständig zu stoppen, die nicht so gut ansprachen, wie ich es nun erwartete. Es gab eine Reihe anderer Übeltäter zu identifizieren – nämlich Kasein, Soja und Mais sowie einige andere Lebensmittel, reich an diesen beiden Aminosäuren ...
… Ich behandle veterinäre epileptische Patienten seit mehreren Jahren überaus erfolgreich mit einer glutamat/aspartatreduzierten Diät (GARD). Meine (freien) Internet-Beratungen während dieser Jahre haben zu einigen faszinierenden Fallgeschichten von Leuten geführt, die diese Prinzipien bei sich selbst angewendet haben. Sowohl Kinder wie auch Erwachsene haben dramatische Reaktionen darauf gezeigt, genau wie meine früheren Studien über epileptische Kinder mit Glutenunverträglichkeit es nahegelegt hatten.“ 211
Natürlich bleibt die Frage, wie es zu den Krampfanfällen kommt – weshalb sich die Neuronen entladen. Symes hat auch darauf eine Antwort gefunden. Sie beruht auf einer ganz neuen Sicht des Virus 219, 117, 220 .
In einem einzigen Wassertropfen können Millionen von Viren schwimmen. Sie werden gewöhnlich als Inbegriff des Bösartigen und Hinterhältigen betrachtet – was schon deshalb keinen Sinn ergibt, weil Viren keine Lebewesen sind (wie bsw. Bakterien oder Schimmelpilze), die überleben wollen und im Kampf ums Überleben versuchen, sich gegen andere Lebewesen durchzusetzen.
Viren bestehen im wesentlichen aus Nukleinsäuren (vom lat. „nucleus“, Kern), Bausteinen des Zellkerns. Es handelt sich zum einen um DNA (Desoxyribonucleinsäure), aus der die Gene bestehen, und zum anderen um RNA (Ribonucleinsäure), mit der DNA-Abschnitte kopiert werden, um damit Proteine herzustellen. Es ist naheliegende, sie als eine Art externer Hilfsprogramme aufzufassen, die im Notfall in die DNA des Zellkerns eindringen und entsprechende Anpassungen leisten können.
Natürlich kennen wir Viren als Krankheitsauslöser. Doch (solange wir die Viren nicht verändert haben) tritt die Krankheit gewöhnlich erst auf, nachdem der Körper - wenn auch nur aus Unwissenheit – lange genug malträtiert worden ist. Die Vermutung liegt also nahe, dass die virale Anpassungen in diesen Fällen einfach nichts mehr ausrichten kann, was zu Überleben führen würde.
Die Funktion des Virus ist im Falle des epileptischen Anfalls gut erkennbar. Glutamat ist ein Nervengift. (In der Tat wird der Hirntod des Menschen durch die „Glutamat-Kaskade“ verursacht, die die Zellen abschaltet.) Das Virus löst die Entladung aus und rettet damit die Neuronen. Der MS- oder ALS-Kranke hat dieses Virus nicht 117, 221, 220. Das überschüssige Glutamat führt zur Zerstörung der nachgeschalteten Nervenzelle.
MS: Multiple Sklerose: vom lat. „multiplex“, vielfach + grch. „skleros“, trocken, spröde, hart: Erkrankung von Gehirn und Rückenmark, bei der sich Verhärtungsherde in den Nervenfasern bilden.
ALS: Amyotrophische Lateralsklerose: vom grch. „a-“, nicht, un- + „mys“, Gen. „myos“, Muskel + „trophein“, nähren, ernähren; vom lat. „lateralis“, seitlich + grch. „skleros“, trocken: Erkrankung der Seitenstränge des Rückenmarks mit nachfolgendem Muskelschwund.
Es gibt in der Tat über 20 Viren, von denen bekannt ist, dass sie epileptische Anfälle auslösen können, darunter das Epstein-Barr-Virus, andere Herpes-Viren, Grippe-, Masern- und Mumps-Viren 211. Einige können sich latent („schlummernd“) im Körper aufhalten.
Die Welt, in der wir leben
„Die Gründerväter der Bundesrepublik Deutschland haben mit der Schaffung einer Verfassung einer demokratischen Struktur nach dem Desaster des Zweiten Weltkriegs Großartiges geleistet. Was sie jedoch nicht wissen konnten, war … , was die gewählten Volksvertreter daraus machen würden. Vor allem konnten sie nicht vorhersehen, in welchem Ausmaß Interessengruppen sich zu Lobbys zusammenschließen, in welchem Umfang sie ihre Interessen selbst gegen die Interessen und Rechte der Bevölkerung durchsetzen würden …
… So entwickelte sich die Bundesrepublik Deutschland von einer Volks- und Volksvertreter-Demokratie zu einer Lobby-, Interessengruppen- und Interessenvertreter-Demokratie. Nichts noch so Gutes und Vernünftiges war fortan durchzusetzen, wenn nicht eine mächtige Interessengruppe mit entsprechenden Verbindungen zu Parlament und Regierung dahinter stand“ (Johann Georg Schnitzer) 222.
Heute können Sie dem noch 20.000 Lobby-Vertreter hinzufügen, die in Brüssel Einfluss auf die EU-Institutionen nehmen 223. Etwa 70 % von ihnen arbeiten für Unternehmen und Wirtschaftsverbände. Sie haben privilegierte Zugänge zu den Kommissaren 224 – den Mitgliedern der Kommission, die die Gesetze vorschlägt - und überhäufen die Abgeordneten des Parlaments – das darüber abstimmt - mit Änderungsanträgen für Gesetzesvorlagen.
Interessengruppen haben immer und immer wieder ihre Interessen zu Ungunsten der Volksgesundheit durchgesetzt 222. Als die Müller in der Lage waren, mithilfe des Elektromotors Mehl auf Vorrat zu mahlen, mussten sie bald feststellen, dass es schnell ranzig wurde. Clevere Wissenschaftler fanden heraus, dass das am Keimling des Korns lag. Also siebte man den Keimling heraus, und mit ihm auch gleich die Schalen (die „Kleie“). Das ganze wurde als „Ballaststoffe“ bezeichnet. Die Wissenschaftler wiesen sogar nach, dass das „vom Ballast befreite“ Weißbrot „leichter verdaulich“ ist. Warum? Weil es den Verdauungstrakt schneller passiert. Ein Witz? Nein, es ist die „wissenschaftliche“ Basis der Mühlenindustrie. Und als die gesundheitlichen Schäden offensichtlich wurden, die durch die Auszugsmehle aufgrund ihres Mangels an Vitaminen, Mineral- und Faserstoffen entstehen - geschah nichts. Zuviel war schon in die großen Mühlen investiert worden.
Es gibt jede Menge an Interessengruppen dieser Art. Sie verkaufen Weizen, Kuhmilch, Haushaltszucker, Kochsalz, Speiseöl, Mineralwasser, Aspartam, Glutamat und dergleichen mehr. Der gesundheitliche Verfall der Bevölkerung ist jedoch ein schleichender Prozess. Er ist für die meisten nicht wahrnehmbar. Nur wenn gestern alle gesund gewesen wären und heute alle krank, würden die Leute es merken.
Doch die Hälfte aller Sterbefälle wird heute von Herz- und Kreislaufkrankheiten verursacht. Jeder fünfte Sterbefall geht auf Krebs zurück. Wir haben fünf Millionen Zuckerkranke. Jedes Jahr werden 33.000 Beinamputationen bei Diabetikern vorgenommen. Gebissverfall hat sich zur allgemeinen Organauflösung entwickelt. Haarausfall wird nicht einmal als Erkrankung wahrgenommen. Fehlfunktionen und Verfall der inneren Organe erreichen nach Nieren, Leber, Darm, Bauchspeicheldrüse, Herz und Kreislauf zunehmend auch das Gehirn. Bei Kindern breitet sich das Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom so rasant aus wie bei Älteren die Demenz (vom lat. „de“, von, von – weg + „mens“, Gen. „mentis“, Verstand; in der alten deutschen Psychiatrie „Verblödung“) - „die Pest des 21. Jahrhunderts“ hat sie ein englischer Politiker genannt 225, 226. Und die Kinder, die heute bereits unter Funktionsstörungen des Gehirns (ADS) leiden, werden um so früher an strukturellen Hirnschäden (Demenz) erkranken.
Die Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen zahlten 1970 in Deutschland 8,2 % ihres Einkommens an ihre Krankenkasse 227, 228. 2015 waren es bereits 14,6 %. Die meisten Krankenkassen kommen damit jedoch nicht aus und erheben noch einen Zusatzbeitrag. Seit 1995 gibt es zusätzlich eine Pflegeversicherung. Der Beitragssatz lag 2015 bei 2,35 % 229. Natürlich wird mit all diesen Mitteln auch ein Gesundheits- oder besser Krankheitssystem betrieben, an dem viele verdienen. Doch letztlich muss der gesundheitliche zu einem wirtschaftlichen Niedergang führen 210.
Viele Wissenschaftler – Ärzte, Zahnärzte, Biologen u. a. - haben sich dafür eingesetzt, das zu verhindern 222. (Siehe auch Bircher 2010.) Johann Georg Schnitzer ist einer von ihnen. Doch „diese ganze Arbeit war ,für die Katzʻ “.
Er kennt auch etliche Geschichten, die gut zeigen, warum das so ist. So entwickelte er ein neues Mahlverfahren, mit dem einiges der Inhaltsstoffe des Korn erhalten werden konnte. Als er den Geschäftsführer eines Mühlenanlagen-Herstellers diesbezüglich kontaktierte, sagte der ihm: „Von Gesundheit verstehen wir nichts, vom Mahlen verstehen wir was, schicken Sie die Unterlagen mal her, wenn sich damit Geld verdienen lässt, machen wir's, sonst nicht!“ Die Mühlenanlage wurde nie gebaut.
Einmal kam ein Team von einer großen Illustrierten zu ihm. Sie machten einen Bericht mit Bildern von seiner Arbeit und seinen Entwicklungen; doch der Bericht wurde nie veröffentlicht. Erst später, als ein Journalist aus der Redaktion ausschied, informierte der ihn davon, warum der Bericht in der Redaktionskonferenz abgelehnt wurde: „Wir haben doch für mehrere hunderttausend Mark Anzeigenaufträge aus der … industrie, die können wir doch nicht für so einen Bericht in die Pfanne hauen!“.
Doch Schnitzer sieht auch: „Das Internet bietet jetzt erstmals eine Möglichkeit der ungefilterten, unzensierten Information und Kommunikation ohne die vielen bisherigen Hürden, sodass z. B. Sie jetzt an dieses Gesundheitswissen gelangen können, ohne dass der Verfasser von der Gnade und der Interessengebundenheit (Politik, Werbeetat usw.!) von Verlegern oder Redaktionen abhängt oder selbst hohe Investitionen auf sich nehmen müsste.“
Das Internet macht sicherlich vieles möglich. Auch diese Artikelreihe wäre nicht ohne Internet entstanden. Es ändert jedoch nichts daran, dass sich die Lebensmittelindustrie und das „Krankheitssystem“, zu dem unser Gesundheitssystem geworden ist, gegenseitig bedingen. Die Industriekost macht Leute krank; und das Krankheitssystem liefert Abhilfen. Auf diese Weise sind die kranken Leute länger in der Lage, die Industriekost zu kaufen; usw. Es ist ein zyklischer Mechanismus – bei dem wirtschaftliche Interessen oft mehr zählen als Sorgfaltspflicht.
Das eigentliche Problem aber liegt wahrscheinlich im Verstand der Leute selbst. Ich habe gesehen, wie es einige in fünf Jahren nicht fertig brachten, sich geeignetes Trinkwasser zu verschaffen. Ich habe beobachtet, wie andere von Jahr zu Jahr kränker wurden und es dennoch ablehnten, auch nur irgendetwas an ihren Ernährungsgewohnheiten zu verändern oder hinsichtlich ihrer Süchte zu unternehmen. Dinge zu verändern setzt voraus, dass man bereit ist, sich die Mühe zu machen, sie zu verstehen, und Verantwortung für das zu übernehmen, was man verstanden hat. Das aber scheint die Fähigkeiten der meisten Leute schlicht und einfach zu überfordern.
Deshalb wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel verändern in Sachen Ernährung – auf welcher Ebene auch immer. Sie aber haben die Möglichkeit, aus dem zu lernen, was ich bei meinen Recherchen gefunden habe. Ich begann sie, um die Epilepsie zu verstehen. Und deshalb ist sie jetzt zu
ENDE
□
Literatur
Birbaumer, Nils & Schmidt, Robert F. (1991). Biologische Psychologie. Berlin, Heidelberg: Springer, 2. Aufl.
Bircher, Ralph (2010). Geheimarchiv der Ernährungslehre. Rottenburg: Kopp, 13. Aufl.
Lippert, Herbert (2000). Lehrbuch Anatomie. München, Jena: Urban & Fischer, 5. Aufl.
Scott, Cyrill (1996). Das schwarze Wunder. Rohe schwarze Zuckerrohr-Melasse. Eine natürliche Wundernahrung. Dulliken: Vita Reform-Verlag, 17. Aufl.
Bilder
Abbildungen 1, 5, 6, 7, 8, 10. 11 und 12 unterliegen der Gemeinfreiheit („public Domain“).
Autor von Abbildung 1:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Zirpe&action=edit&redlink=1
Autor von Abbildung 5:
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Hgrobe
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:MarkusZi
Autor von Abbildung 6:
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Jonathan_Haas
Autor von Abbildung 7:
Generated by Life Science Databases(LSDB)
Autor von Abbildung 8:
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
Autor von Abbildung 10:
Helmut Hirner
Autor von Abbildung 11:
Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com)
Autoren von Abbildung 12:
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Chris_73
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Diberri
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Tomtheman5
Videos
V1 https://www.youtube.com/watch?v=zP5LidA7LoI
V2 https://youtu.be/nrahc-KfBRo
V3 https://youtu.be/pvFRLIjOLOU
V4 http://www.youtube.com/watch?v=i16kBs1gxWU
Web Links
2 Getreide und Getreideprodukte . Was ist drin?
11 Kohlenhydrate 2 Folien - Chemie
12 Ausmahlungsgrad – Wikipedia
13 http://www.was-ist-gesund.de/ernaehrung/weissmehlprodukte/
14 Die Geschichte vom schönen weißen Mehl und den Laborratten
16 Gesundheit durch vitalstoffreiche, vollwertige Ernährung
18 Die Zuckerrübe Sachinformationen - information.medien.agrar eV
19 Zuckerfabrikation – Wikipedia
20 Zuckergewinnung > Zucker > Südzucker
21 Zuckerherstellung aus Zuckerrohr /- rüben
22 Kristallisation – Wikipedia
24 Karamellisieren – Wikipedia
26 Zuckerrübensirup – Wikipedia
32 Zucker - Auswirkungen auf den Körper
34 Salz
37 Salz
50 Gesetz der konstanten Proportionen – Wikipedia
51 Joseph Louis Proust – Wikipedia
52 Folgen des Defizits an vollwertigem Salz und Überschuss von raffiniertem Speisesalz
53 Bluthochdruck: Böses Salz | Wissen | ZEIT ONLINE
54 Unser Speisesalz = Natriumchlorid - www.initiative.cc
55 Salz - weißes Gold der Erde
56 Hypertonie: Wie Salz den Blutdruck hochtreibt - News - FOCUS Online - Nachrichten
57 UniversitätsKlinikum Heidelberg: Warum zu viel Salz den Blutdruck erhöht
58 http://de.wikipedia.org/wiki/Louis_Pasteur
59 http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelkonservierung
60 http://de.wikipedia.org/wiki/Pasteurisierung
61 http://www.chemie.de/lexikon/Pasteurisierung.html
62 http://de.wikipedia.org/wiki/Ultrahocherhitzung
63 http://de.wikipedia.org/wiki/Abkochen
64 http://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtsaft
65 http://www.naturkost.de/basics/p11819
66 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/frsaftv_2004/gesamt.pdf
67 http://www.zentrum-der-gesundheit.de/ascorbinsaeure-ia.html
68 http://de.wikipedia.org/wiki/Gelatine
69 http://www.gelita.com/de/loesungen-und-produkte/gelatine-herstellung-sechs-schritten-zum-endprodukt
70 http://de.wikipedia.org/wiki/Bentonit
72 http://de.wikipedia.org/wiki/Tannine
71 http://de.wikipedia.org/wiki/Gerbstoffe
73 http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nung
74 http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Lebensmittelbuch
75 http://de.wikipedia.org/wiki/Dicksaft
76 http://de.wikipedia.org/wiki/Konzentrat
77 http://www.naturkost.de/basics/p11609.htm
78 http://de.wikipedia.org/wiki/Sirup
79 http://de.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%BCsesaft
80 http://www.zuckerverbaende.de/aktuell/presse-aktuelle-infos
81 http://www.vitabiosa-em.de/sub/bitter.html
82 http://www.zwischen-zeit.com/Bitterstoffe.html
83 http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%BC%C3%9Fstoff
84 http://de.wikipedia.org/wiki/Saccharin
85 http://www.zusatzstoffe-online.de/zusatzstoffe/294.e954_saccharin.html
86 http://de.wikipedia.org/wiki/Cyclamat
87 http://www.zusatzstoffe-online.de/zusatzstoffe/294.e954_saccharin.html
88 http://de.wikipedia.org/wiki/Aspartam
89 http://www.google.com/patents/EP0036258A2?cl=en
90 http://www.wnho.net/fda_petition1.doc
91 http://www.division-franken.de/?p=2202
92 http://www.wnho.net/whopper.htm
93 http://www.wnho.net/fda_92_symptoms_on_aspartame.htm
94 https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Rumsfeld
95 http://ec.europa.eu/food/fs/sfp/addit_flavor/flav10_de.pdf
96 http://www.suessstoff-verband.de/suessstoffe/aspartam/
98 http://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/aspartame.htm
98 http://www.projekt-gesund-leben.de/2013/08/aspartam-wie-gefaehrlich-sind-light-produkte/
100 http://www.prlog.org/10050221-testimonial-ralph-walton-md-former-psychiatry-professor-to-hawaii
101 http://www.zentrum-der-gesundheit.de/ia-aspartam-suessstoff.html
102 https://de.wikipedia.org/wiki/Phenylalanin
103 https://de.wikipedia.org/wiki/Phenylketonurie
104 http://www.zeitenschrift.com/news/aspartam-suesses-gift#.VaMg2fntlBc
105 https://de.wikipedia.org/wiki/Methanol
106 http://www.chemieunterricht.de/dc2/r-oh/meoh-gift.htm
107 http://www.chemieunterricht.de/dc2/r-oh/meoh-syn.htm
108 http://flexikon.doccheck.com/de/Methanolvergiftung
109 http://www.bernd-leitenberger.de/selbstgebranntem-blind.shtml
110 http://www.cvuas.de/pub/beitrag.asp?subid=1&Thema_ID=2&ID=1244
111 http://www.zentrum-der-gesundheit.de/pdf/aspartam-warheit.pdf
112 https://www.wasserklinik.com/aspartam-ein-suessstoff-und-seine-nebenwirkungen/
113 https://fcoegsundheit.wordpress.com/2014/01/31/susstoff-aspartam-und-seine-nebenwirkungen/
114 http://www.wahrheitssuche.org/aspartam.html
115 https://de.wikipedia.org/wiki/Asparagins%C3%A4ure
116 https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/dr-harold-waisman/
117 http://dogtorj.com/main-course/epilepsy-and-diet/the-epilepsy-diet-made-simple/
118 https://de.wikipedia.org/wiki/Blut-Hirn-Schranke
119 http://www.vitatest.de/fileadmin/user_upload/Aufsaetze/praeventiv/AufsatzErregung.pdf
120 https://de.wikipedia.org/wiki/Acesulfam
121 https://de.wikipedia.org/wiki/Aspartam-Acesulfam-Salz
122 http://www.food-detektiv.de/e_nummer_ausgabe.php?id=10000020
123 http://www.suessstoff-verband.de/suessstoffe/verwendung/suesskraft-dosierung/
124 https://de.wikipedia.org/wiki/Neotam
126 http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_DE_CB4274454.htm
127 http://www.enjoyfuture.de/blog/umweltgifte/super-aspartam-neotam.html
128 https://de.wikipedia.org/wiki/Ajinomoto
129 http://wakeup-world.com/2014/07/08/advantame-the-new-improved-artificial-sweetener-approved-by-fda/
130 http://lsfm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/life_sciences/_Institute_und_Zentren
131 http://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/sweeteners.htm
133 https://de.wikipedia.org/wiki/Fleischextrakt
134 https://de.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BChw%C3%BCrfel
135 http://de.inforapid.org/index.php?search=Fertigsuppe
136 https://de.wikipedia.org/wiki/Fertiggericht
137 https://de.wikipedia.org/wiki/Fertigsuppe
138 https://de.wikipedia.org/wiki/Instantsuppe
139 https://de.wikipedia.org/wiki/Convenience_Food
140 http://de.inforapid.org/index.php?search=Fertiggericht
141 http://www.zentrum-der-gesundheit.de/fertigprodukte.html
142 https://de.wikipedia.org/wiki/Lebensmittelzusatzstoff
143 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Lebensmittelzusatzstoffe
144 http://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/additives.htm
146 http://www.zusatzstoffe-online.de/information/681.doku.html
147 https://de.wikipedia.org/wiki/NOAEL
151 https://de.wikipedia.org/wiki/Aroma
153 http://www.mzo-wiki.de/rats-os/08-eb-ch11a/index.php/Herstellung/VonDuft-UndAromastoffen1
154 https://books.google.de/books?
155 http://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/aromavorstufe/712
156 http://www.efsa.europa.eu/de/topics/topic/flavourings.htm
157 http://www.efsa.europa.eu/de/press/news/121001b.htm
158 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2012:267:FULL&from=EN
160 http://www.bfr.bund.de/de/aromastoffe_und_aromen-54440.html
162 http://www.vzhh.de/ernaehrung/106987/Kennzeichnung%20Aroma.pdf
163 http://schrotundkorn.de/lebenumwelt/lesen/201104b05.html
164 https://de.wikipedia.org/wiki/Glutamate
165 https://de.wikipedia.org/wiki/Glutamins%C3%A4ure
166 https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Ritthausen
167 https://de.wikipedia.org/wiki/Ikeda_Kikunae
168 https://de.wikipedia.org/wiki/Umami
169 http://www.zentrum-der-gesundheit.de/umami-geschmacksverstaerker-ia.html
170 https://de.wikipedia.org/wiki/Mononatriumglutamat
171 http://www.gzl.com/sortiment/streuwuerze/die-glutamat-story.html
172 http://www.milchlos.de/milos_0404.htm
173 https://en.wikipedia.org/wiki/Generally_recognized_as_safe
174 https://en.wikipedia.org/wiki/Glutamate_flavoring
175 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45950229.html
176 http://www.zeit.de/1969/45/glutamat-unter-anklage
177 https://books.google.de/books?
178 http://www.taz.de/1/archiv/?dig=2004/02/07/a0249
179 http://www.bfr.bund.de/cm/343/ueberempfindlichkeitsreaktionen_durch_glutamat_in_lebensmitteln.pdf
180 http://www.hafenmuehle.de/mononatriumglutamat/
181 https://de.wikipedia.org/wiki/Geschmacksverst%C3%A4rker
182 http://www.alnatura.de/de-de/kochen-und-geniessen/warenkunde/h/hefeextrakt
183 https://de.wikipedia.org/wiki/Spontang%C3%A4rung
184 https://de.wikipedia.org/wiki/Hefeextrakt
185 http://www.natuerlich-online.ch/fileadmin/Natuerlich/Archiv/2004/03-04/71_Plattform_Glutamat.pdf
186 https://dasmigraeneprojekt.wordpress.com/2011/04/09/liste-mit-bezeichnungen-fur-glutamat/
187 https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrolyse
188 https://de.wikipedia.org/wiki/Maggi-W%C3%BCrze
189 http://www.avogel.de/ernaehrung_gesundheit/ihre-ernaehrung/themenuebersicht/glutamat.php
190 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1333&from=DE
191 https://de.wikipedia.org/wiki/John_W._Olney
192 https://de.wikipedia.org/wiki/Rezeptor_(Physiologie)
193 https://de.wikipedia.org/wiki/Sinnesorgan
194 https://de.wikipedia.org/wiki/Glutamin
195 http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/aktionspotential/293
196 https://de.wikipedia.org/wiki/Ionenkanal
197 https://de.wikipedia.org/wiki/Transportprotein
198 http://dr-bieger.de/gamma-amino-buttersaeure-gaba-neurotransmitter-mit-angst-loesender-wirkung/
199 http://www.spektrum.de/lexikon/neurowissenschaft/glutamatrezeptoren/4850
200 http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=18856
201 https://de.wikipedia.org/wiki/NMDA-Rezeptor
202 https://de.wikipedia.org/wiki/Ionotroper_Rezeptor
203 https://de.wikipedia.org/wiki/Ligand_(Biochemie)
204 https://books.google.de/books?
205 http://www.medizinfo.de/kopfundseele/alzheimer/memantine.shtml
206 https://de.wikipedia.org/wiki/Excitotoxizit%C3%A4t
207 https://de.wikipedia.org/wiki/Arachidons%C3%A4ure
208 http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/8/bc/vlu/botenstoffe/second_messenger.vlu.html
209 https://de.wikipedia.org/wiki/Peroxinitrit
210 http://flexikon.doccheck.com/de/Glutamat
211 http://dogtorj.com/main-course/the-g-a-r-d-the-glutamate/epilepsy-and-the-g-a-r-d/
212 http://dogtorj.com/main-course/news-flash/
213 http://www.zentrum-der-gesundheit.de/glutamat.html
214 http://www.zentrum-der-gesundheit.de/glutamat-ia.html
215 https://de.wikipedia.org/wiki/Glaukom
216 http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Mononatriumglutamat.html
217 https://de.wikipedia.org/wiki/Restless-Legs-Syndrom
218 http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Erkrankungen/Restless-Legs-Syndrom/News/85809.php
219 https://de.wikipedia.org/wiki/Viren
220 http://www.dogtorj.com/main-course/viruses-friend-or-foe/
221 http://www.dogtorj.com/appetizers/medical-conditions-k-z/multiple-sclerosis/
222 http://www.dr-schnitzer.de/wsn001.htm
223 https://www.lobbycontrol.de/schwerpunkt/lobbyismus-in-der-eu/
224 https://ec.europa.eu/commission/2014-2019_de
225 https://www.deutsche-alzheimer.de/uploads/media/pm_dalzg_08252015_welt-alzheimerreport_2015.pdf
227 http://www.cecu.de/krankenkassenbeitrag.html
228 https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkasse-beitrag/beitragsrechner/
229 http://vergleich-pflege.versicherung/pflegeversicherungsbeitrag.html